Friedrich Wilhelm Beneke
Biografie - Teil 1
Friedrich Wilhelm Beneke und dem Autor seiner Biografie und Autobiografie Klaus Beneke haben wir viel zu verdanken!
Die salzigen Heilquellen Bad Nauheims, so wie die Forschung, Lehre und Anwendung eines begnadeten Mediziners, setzten Maßstäbe und sind Grundlage und Teil unseres heutigen Wissens und unserer
Gesundheit. Wir danken Klaus Beneke für den Einblick in die Welt und das Leben von Friedrich Wilhelm Beneke und dass wir dieses veröffentlichen dürfen! "Dank der Heilerfolge von F. W.
Beneke stieg Bad Nauheim zum Weltbad für Herz- und Kreislauferkrankungen auf. Unter den Gästen findet man u. a. die Kaiserinnen Elisabeth von Österreich (Sisi) (1898), Alexandra von Rußland
(1912) und Auguste Viktoria von Deutschland (1912)." ONLINE MUSEUM Bad Nauheim,
22.06.2015
Die Beneke-Biografie und Beneke-Autobiografie, so wie Veröffentlichungen von Klaus Beneke über den Benke-Brunnen und das Beneke Zimmer in Bad Nauheim sind unter Downloads zu finden.
Biografie von Klaus Beneke
über
Friedrich (Conrad Ludewig Anton) Wilhelm Beneke
(27. März 1824 Celle – 16. Dezember 1882 Marburg)
Leibarzt des Herzogs von Oldenburg, Badearzt in (Bad) Nauheim, Professor und Direktor des pathologisch-anatomischen Instituts der Universität Marburg, Mitbegründer der naturwissenschaftlichen
Balneologie und der Seehospize an den Nordseeküsten, Kolloidwissenschaftler

Porträt von Friedrich Wilhelm Beneke am Beneke-Brunnen in Bad Nauheim
Verfasser und Copyright
Klaus Beneke
Institut für Anorganische Chemie der
Christian-Albrechts-Universität Kiel
D-24098 Kiel
Tel. (0431) 880-7445
Telefax (0431) 880-1520
E-Mail: beneke@ac.uni-kiel.de
www.uni-kiel.de/anorg/lagaly/group/klausSchiver/d_klausSchiver.htm
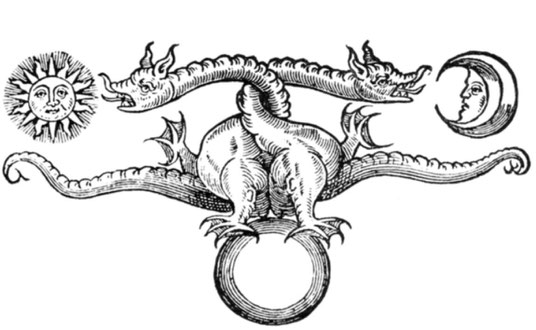

Meiner Mutter Charlotte Beneke
herzlich gewidmet
Sie befinden in der
Biografie - Teil 1:
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Vorfahren von Friedrich (Conrad Ludewig Anton) Wilhelm Beneke
Friedrich Wilhelm Beneke
Studium der Medizin in Göttingen
Celle
Deutsches Hospital in London
Hannover
Verein zur Förderung für gemeinschaftliche Arbeiten zur Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde
Oldenburg
Balneologie vom Mittelalter bis zu F. W. Beneke
Nauheim (ab 1869 Bad Nauheim)
Marburg
Bäderheilkunde und Verein für Kinderheilstätten an der Nordsee
Krankheiten, für die damals Seekuren empfohlen wurden
1. Skrofulose
2. Chlorose
3. Rachitis
4. Tuberkulose
5. Asthma bronchiale
6. Dermatologische Erkrankungen
Kinderhospiz auf Norderney
Die Leitenden Ärzte und Chefärzte des Seehospizes „Kaiserin Friedrich“
Tod von Friedrich Wilhelm Beneke
Beneke-Brunnen in Bad Nauheim
Beneke-Strassen in Deutschland
Kurzlebenslauf von Friedrich Wilhelm Beneke
Stammtafel der Familie Friedrich Wilhelm Beneke und einem Teil der Vor- und Nachfahren
Literaturverzeichnis
Werke und Publikationen über Friedrich Wilhelm Beneke
Gesamtverzeichnis der Werke und Publikationen von Friedrich Wilhelm Beneke
--------
Vorwort zur Biografie
Das interessante Leben von Friedrich (Conrad Ludewig Anton) Wilhelm Beneke (27. März 1824 Celle - 16. Dezember 1882 Marburg) wird in dieser Biografie beschrieben. Dabei wird besonders auf sein wissenschaftliches Werk eingegangen. Nach dem Studium der Medizin in Göttingen und Prag war er u. a. Arzt in Celle und am Deutschen Hospital in London, Leibarzt des Großherzogs Nikolaus Friedrich Peter II. von Oldenburg, Geheimer Medizinalrat, Badearzt in (Bad) Nauheim, Professor und Direktor des pathologisch-anatomischen Instituts der Universität Marburg, Mitbegründer der naturwissenschaftlichen Balneologie und der Seehospize an den Nordseeküsten.
Naturwissenschaftliche Forschung in der Medizin war zu dieser Zeit nicht üblich und wurde von Friedrich Wilhelm Beneke früh eingefordert. Dieses wiederum geht auf Arbeiten des Chemikers Justus von Liebig zurück mit dem Friedrich Wilhelm Beneke ab 1847 in einem unregelmäßigen wissenschaftlichen Briefwechsel stand.
Die mit 29 Jahren niedergeschriebene Autobiografie von Friedrich Wilhelm Beneke (1853 in Oldenburg) wird ebenfalls in diesem Buch gesondert mit Zitaten veröffentlicht und ist ein Zeitzeugnis. Hier beschrieb F. W. Beneke besonders gut seine Jugendzeit, das Studium der Medizin und die Hochschullehrer in Göttingen und Prag. Die Autobiografie wurde aber nicht für diese Biografie als Zitatenquelle benutzt.
Ich danke ganz besonders Frau Brigitte Faatz vom Stadtarchiv Bad Nauheim für Hinweise und Übersendung von Unterlagen, sowie erste Hinweise und Überlassung von 49 Seiten der Autobiographie von Friedrich Wilhelm Beneke.
Der Pflegedirektorin a. D. im Seehospiz „Kaiserin Friedrich“ auf Norderney, Schwester Lydia Latzke vom Diakonissen-Mutterhaus „Kinderheil“/Bad Harzburg bin ich ebenfalls sehr zu Dank verpflichtet für Material und viele Unterlagen über das Seehospiz „Kaiserin Friedrich“ auf Norderney und dem Diakonissen-Mutterhaus „Kinderheil“. Auch danke ich dem ehemaligen Chefarzt des Seehospiz auf Norderney Prof. Dr. Hermann Manzke für die anregenden Diskussionen.
Weiterhin danke ich Frau Ulfen vom Seehospiz Norderney gGmbH, Benekestraße 27 in D-26548 Norderney, für wertvolle Auskünfte.
Ein ganz besonderer Dank geht an Prof. Dr. Dr. h. c. Gerhard Lagaly,
Institut für Anorganische Chemie der Christian-Albrechts-Universität Kiel, für die kritische Durchsicht des Manuskripts.
Ich danke allen die mich bei dieser Arbeit unterstützt haben.
Klaus Beneke, Kiel und Preetz in Schleswig-Holstein am 1. Januar 2005
Vorfahren von Friedrich (Conrad Ludewig Anton) Wilhelm Beneke
Friedrich (Conrad Ludewig Anton) Wilhelm Benekes Großvater war Johann Conrad Beneke (02.05.1755 Hameln - 15.10.1808 Celle) Advokat und Protonotar beim Ober-Appelationsgericht in Celle. Er war der älteste Sohn des Uhrmachers, Senators, Forstinspektors und Diakonus in Hameln, Anton Ludewig Beneke (01.03.1731 Hameln 24.03.1806 Hameln), und Magareta Elisabeth Beneke, geb. Beneke (03.10.1731 Celle 09.12.1789 Hameln) und hatte neun Geschwister, von denen sechs schon in jüngeren Jahren fast durchweg an Schwindsucht starben.
Johann Conrad Beneke war viermal verheiratet. Seine ersten drei Frauen starben sehr früh. In erster Ehe (1779 in Kiel) war er mit Juliane Elisabeth Cramer, der Tochter von Johann Andreas Cramer (27.01.1723 Jöhstadt bei Annaberg im sächsischen Erzgebirge - 12.06.1788 Kiel), Prorektor und Professor für Theologie an der Universität Kiel, verheiratet. Johann Andreas Cramer war Herausgeber der Zeitschrift „Beyträge zur Beförderung theologischer und andrer wichtigen Kenntnisse von Kielischen und auswärtigen Gelehrten“ von 1. 1777 bis 4. 1783 (erschienen bei Bohn, Kiel, Hamburg).1
-------------
1 Johann Andreas Cramer wurde am 27. Januar 1723 in Jöhstadt bei Annaberg im Erzgebirge als Sohn eines Pfarrers geboren. Er besuchte die Fürstenschule in Grimma und studierte ab 1742 Theologie in Leipzig. Er neigte schon sehr früh zur Dichtung und schönen Literatur. Cramer wirkte ab 1748 als Pfarrer in Cröllwitz bei Merseburg, widmete sich kirchen- und dogmengeschichtlichen Arbeiten und wurde 1750 Oberhofprediger und Konsistorialrat in Quedlinburg. 1754 wurde Cramer von König Friedrich V. von Dänemark zum deutschen Hofprediger nach Kopenhagen berufen. Er erwarb sich bald den Ruhm eines Kanzelredners und erhielt 1765 zugleich die theologische Professur an der Universität und 1767 die theologische Doktorwürde. Nach dem Tode Friedrich V. 1766 und der Entlassung von Cramers Gönner Graf von Bernstorff (1770) wurde dieser 1771 vom Kabinettsminister Graf von Struvensee wegen seiner freimütigen Predigten gegen die sittliche Laxheit der vornehmen Gesellschaft seines Amtes entsetzt und des Landes verwiesen. Cramer nahm den Ruf als Superintendent in Lübeck an. Nach dem Sturz von Graf von Struensee (1772) und dessen Hirichtung wurde Cramer 1774 von Christian VII. als Prokanzler und 1. Professor der Theologie an die Universität Kiel berufen und 1784 zum Kanzler und Kurator der Universität ernannt. Cramer gründete 1781 das erste Kieler Lehrerseminar. Er war ein gelehrter Theologe und fruchtbarer Schriftsteller, ein gefeierter Redner und Dichter der Aufklärungszeit. Er dichte über 400 geistliche Lieder, teils in dem Hymnusstil Friedrich Gottlieb Klopstocks, teils lehrhaft in der Art seines Freundes Christian Fürchtegott Gellert. Waren die Lieder Cramers zahlreich in den Gesangsbüchern vertreten, findet man heute nur noch vereinzelte Strophen aus einem Abendmahlslied: „Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen: wir sind, die wir von einem Brote essen, aus einem Kelche trinken, alle Brüder und Jesu Glieder“. Teilweise ist auch noch das Tauflied „Ewig, ewig bin ich dein, teuer dir, mein Gott, erkaufet, bin auf dich, um dein zu sein, Vater, Sohn und Geist, getaufet“, von Cramer zu finden. Cramer hat auch den 104. Psalm bearbeitet: „Herr, dir ist niemand zu vergleichen, kein Lob kann deine Größ erreichen, kein noch so feuriger Verstand“ und hat vielealte Kirchenlieder umgedichtet. Johann Andreas Cramer starb am 12. Juni 1788 in Kiel (BAUTZ, 1990). Der ältesteste Sohn von Johann Andreas Cramer und Bruder von Juliane Elisabeth Cramer, verheiratete Beneke (gest. 08.07.1780), Carl Friedrich Cramer (1752-1807) war Hochschullehrer, Buchhändler, Verleger und Schriftsteller, und lebte ab 1794 als Anhänger der französischen Revolution im Pariser Exil. Er hinterließ ein ebenso vielseitiges wie vielgestaltiges Werk. Er übertrug die Schriften Rousseaus ins Deutsche, veröffentlichte eigene Reisetagebücher und gab ein modernes Musikmagazin heraus. Überregionale Anerkennung erlangte der Hochschulprofessor der griechischen und orientalischen Sprachen an der Universität Kiel als Editor und Biograph des Odendichters und Verfassers des "Messias" Friedrich Gottlieb Klopstock. Mit ihm verband ihn eine enge Freundschaft. Als glühender Anhänger der Französischen Revolution wurde Carl Friedrich Cramer 1794 seines Amtes als Professor der Kieler Universität enthoben und zum sofortigen Verlassen der Stadt aufgefordert. Der Staatsfeind siedelte nach Paris über und berichtete von dort über die Ereignisse in der französischen Metropole. Dort setzt seine subversive Arbeit mit Vergnügen fort, zumal er in der Lotterie (!) ein hübsches Haus an der Rue des Bons Enfants gewonnen hat. Dank diskreter Unterstützung durch den Hamburger Kaufmann Sieveking kann er dort einen Buchladen samt Druckerei aufbauen. Mit Besuchern und Revolutionstouristen wie Wilhelm von Humboldt erörterte er seine Idee einer europäischen Gesamtstaatkultur und erweist sich so als ein intellektueller Repräsentant eines modernen Europa (SCHÜTT, 2004).
Die Ehe von Johann Conrad Beneke und Juliane Elisabeth Beneke, geb. Cramer blieb kinderlos. Juliane starb nach kurzer Ehe am 8. Juli 1780 im 24. Lebensjahr wohl am Kindbettfieber.
Johann Conrad Beneke (1755 - 1808)
Johann Anreas Cramer (1723 - 1788)
In zweiter, dritter und vierter Ehe war Johann Conrad Beneke mit den Töchtern des „Hofsekretärs beim Hohen Tribunal“ in Celle (später wohl Hannover) Karl Burchard Brandes verheiratet, der eine töchterreiche Familie hatte; eine vierte und fünfte Tochter kommen auch als Paten in der Familie vor.

Carl Friedrich Cramer (1752 - 1808)
In zweiter Ehe (15.07.1781) war Johann Conrad Beneke mit Georgine Friderike Rebekka Brandes (gest. 28.10.1784; 25 Jahre alt) verheiratet. Aus dieser Ehe stammen drei Kinder: Charlotte Friderike Elisabeth Beneke (11.03.1782 29.03. 1783), ein Sohn, dessen Name nicht bekannt ist (geb. und gest. 08.04.1783) und Karl Ludwig Beneke (05.04.1784 - 09.10.1794) der zehnjährig verstarb.
Die dritte Ehe feierte Johann Conrad Beneke am 22.02.1786 mit Karoline Dorothea Brandes (gest. 28.10.1792; 29 Jahre alt). Aus dieser Ehe gingen vier Kinder hervor. Die Zwillinge Friderike Dorothee Elisabeth Beneke (11.10.1786 23.02.1789) und Heinrich Friedrich Wilhelm (gerufen Fritz) Beneke (11.10.1786, gest. in russischer Gefangenschaft 1813). Er und sein Bruder Georg Wilhelm Beneke (geb. 15.02.1790, gefallen in Rußland 1812), machten den Napoleonischen Feldzug nach Rußland mit. Zwischen beiden der 1788 geborene Georg August Beneke (08.05.1788 Celle - 15.07.1858 Celle), der Vater von Friedrich Wilhelm Beneke (1824 - 1882).
Die vierte Ehe von Johann Conrad Beneke wurde am 07.09.1793 mit Wilhelmine Henrietta Brandes (gest. 10.10.1824; etwa 59 Jahre alt) geschlossen. Aus dieser Linie stammt der Schreiber dieser Zeilen. Aus der vierten Ehe gingen sieben Kinder hervor, von denen vier nach kürzester Zeit starben: Johanna Dorothea Elisabeth Beneke (08.07.1794 Celle - 10.03.1795 Celle), Elisabeth Maria Luise Beneke (geb. und gest. 07.07.1795 Celle), Ernestine Dorothea Beneke (12.10.1797 Celle - 03.11.1800 Celle), Ernst Gottlob Beneke (26.06.1801 Celle - 13.04.1804 Celle). Übrig blieben nur Karl Ludwig Heinrich Beneke (31.07.1799 Celle - 22.07.1871 Bremen), Sophie Luise Beneke (14.07.1796 Celle - ? Kassel) und ihre Schwester Karoline Henriette Beneke (14.10.1805 Celle - 06.07.1867 Kassel, die beide mit Karl (Heinrich) Koppen (12.03.1800 Kassel - 22.02.1862 Kassel) vermählt waren.

Georg August Beneke (1788 - 1858)
und seine Frau Caroline Artemisa Beneke, geb. Hansing (1795-1875)
Als eigentliche Stammhalter der Beneke´schen Familie sind also nur übrig geblieben Georg August Beneke (aus der dritten Ehe) und sein Stiefbruder Karl Ludwig Heinrich (aus der vierten Ehe), mein Ururgroßvater (Klaus Beneke, geb. 1944).
Johann Conrad Beneke hatte eine gute und sichere Stellung, wurde aber durch den Tod dreier Frauen und den der vielen Kindern vom Schicksal arg gebeutelt. Er war längere Zeit krank und starb 54jährig, wohl an Schwindsucht, in Celle. Seine letzte Frau Wilhelmine Henrietta Beneke überlebte ihn um 16 Jahre.
Georg August Beneke (08.05.1788 Celle - 15.07.1858 Celle) arbeitete in Celle als angesehener Jurist, Protonotar und Justizkanzleisekretär. Er heiratete um Ostern 1816 Caroline Artemisia Hansing (07.01.1795 Harburg - 07.01.1875 Celle), die Tochter des Harburger Bürgermeisters Engelhard Hansing. Deren Großvater war ein französischer Emigrant, Pfarrer Gautier in Hamburg. Caroline Artemisia Beneke geb. Hansing war eine gottesfürchtige Frau mit praktischem Sinn. Auch soll sie eine Feindin der Verweichlichung in der Erziehung ihrer Kinder und aller Schwärmerei abhold gewesen sein. Aus der Ehe gingen neun Kinder hervor, von denen drei Söhne, Karl Ludwig Heinrich Beneke (05.07.1817 Celle - 11.09.1880 Philadelphia), Friedrich Georg August Beneke (25.11.1828 Celle - ? Chicago) und Carl Friedrich Heinrich (Henry) Beneke (17.12.1835 Celle - 17.12.1891 St. Louis) später in die USA auswanderten.
Die anderen Kinder waren Manon Beneke (14.07.1819 Celle - 12.07.1847 Celle), Johanne Auguste Sophie Beneke (28.12.1822 Celle - 29.09.1907 Bremen), Emma Louise Helene Beneke (05.02.1826 Celle - 28.02. 1827 Celle), Auguste Charlotte Heloise Beneke (18.07.1832 Celle - 24.02.1852), Caroline Charlotte Beneke (09.01.1834 Celle - 07.03.1900) sowie Friedrich Conrad Ludewig Anton Wilhelm Beneke (24.03.1824 Celle - 16.12.1882 Marburg) über den hier ausführlich berichtet werden soll.
Friedrich (Conrad Ludewig Anton) Wilhelm Beneke
Friedrich Wilhelm Beneke wurde am 27. März 1824 in Celle in der Zöllnerstraße 41 in der späteren Rottmann´schen Apotheke geboren und war neben den Schwestern der einzige Junge, der später in Deutschland blieb. Er wurde 1830 in die Elementarschule in Celle eingeschult, wechselte aber schon Ostern 1831 auf das Gymnasium in Celle und bestand im Herbst 1842 das Abitur (SCHMITTER, 1986). Von seinem Vater Georg August Beneke erbte Friedrich Wilhelm Beneke „eine hervorragende Begabung zur Musik“ wie sein Sohn Rudolf Beneke (22.05.1861 Marburg - 01.04.1945 Marburg) schrieb (BENEKE R, 1939).
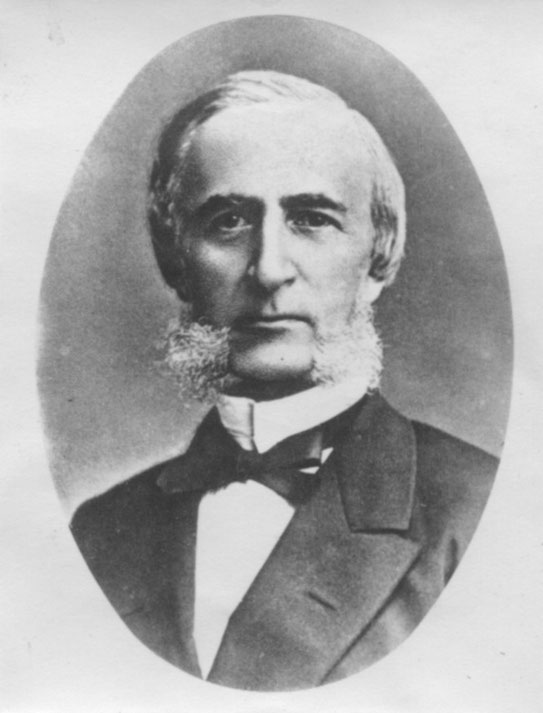
Friedrich Wilhelm Beneke (1824 - 1882)
Die Zöllnerstraße in der Friedrich Wilhelm Beneke geboren wurde gehört zu den ältesten Straßen in Celle. Sie war eine für damalige Zeiten ungewöhnlich breite Straße und führte zum Celler Schloß. Sie entstand bereits zur Zeit der Stadtgründung 1292 durch den Neugründer der Stadt Celle Herzog Otto den Strengen. Die Stadt erstreckte sich zunächst nur auf den Bereich der heutigen Straßenzüge Kanzleistraße Schuhstraße im Norden und Stechbahn - Zöllnerstraße im Süden, die auf die Burg ausgerichtet waren, während der als Hauptverteiler dienende Straßenzug Poststraße Markt von Süden zum Allerübergang führte. Im Stadtzentrum, am Markt, lagen Rathaus und Kirche. Im Stadtzentrum, am Markt, lagen Rathaus und Kirche. Die Stadt war durch Gräben und Mauern geschützt. Unter Ernst dem Bekenner wurde sie um 1530 nach Süden bis zum heutigen Südwall erweitert. Drei Stadttore bildeten den Eingang zu ihr: das Westceller Tor im Westen, das Altenceller Tor im Osten und das Hehlentor im Norden. Sie wurden um 1790 abgebrochen.

Geburtshaus von Friedrich Wilhelm Beneke in der Zöllnerstraße 41 in Celle,
Heute Ratsapotheke (Foto November 2004)
Studium der Medizin in Göttingen
Mit 18 Jahren, begann Friedrich Wilhelm Beneke 1842 mit dem Studium der Medizin an der Universität Göttingen. Seine akademischen Lehrer waren:
Konrad Johann Martin Langenbeck (05.12.1776 Horneburg an der Lühe 24.01.1851 Göttingen). Langenbeck wirkte ab 1802 als Privatdozent und Wundarzt am akademischen Hospital unter der Leitung von Carl Gustav Himly (1772 - 1837). Er wurde 1804 zum außerordentlichen Professor (Extraordinariat) für Chirugie in Göttingen ernannt und gründete 1807 ein eigenes klinisches Institut für Chirugie und Augenheilkunde in Göttingen. Im Jahre 1814 wurde Langenbeck zum ordentlichen Professor der Anatomie und Chirurgie in Göttingen ernannt und General-Chirugus der Hannoverschen Armee. In letztere Eigenschaft leitete er 1815 die Versorgung der verwundeten Soldaten in den Lazaretten von Antwerpen und Brüssel. 1816 Ernennung zum Hofrat, 1840 zum Ober-Medizinalrat. 1829 erfolgte unter Langenbecks Leitung der Neubau eines anatomischen Instituts. Im Jahre 1849 wurde die Professur von Langenbeck auf Anatomie beschränkt, um eine eigene Professur für Chirurgie an der Universität Göttingen zu gründen. Neben seiner Tätigkeit als Anatom war Langenbeck, der als Sonderling galt, ein fanatischer Chirurg. Er erklärte kurz vor seinem Tod in der Klinik: „Die Menschen zerfallen in solche, die operieren, und solche, die operiert werden.“ Als die berühmten „Göttinger Sieben“, darunter die Gebrüder Grimm, ihres Amtes enthoben wurden, bemerkte Langenbeck in seiner Vorlesung: „Ob so ein paar alte Märchen hier in Göttingen sind oder nicht, darauf kommt es nicht an.“
Der Zoologe und Physiologe Rudolph Wagner (30.06.1805 Bayreuth - 13.05.1864 Göttingen) studierte von 1822 bis 1824 in Erlangen, von 1824 bis 1826 in Würzburg, wo er auch promovierte. Nach Studien in Paris (vergleichende Anatomie), Reisen in die Normandie und an das Mittelmeer (Forschung an niederen Tieren) und Cagliari (Geologie) erfolgte eine Anstellung als Prosektor in Erlangen, wo er sich 1829 habilitierte. Wagner wirkte ab 1833 als ordentlicher Professor der Zoologie an der Universität Erlangen und wechselte 1840 an die Universität Göttingen, wo er Ordinarius für Physiologie, vergleichende Anatomie und Zoologie wurde. Er entdeckte den Keimfleck in der Eizelle des Menschen und 1852 mit dem Anatomen und Physiologen Georg Meißner (1829 Hannover - 1905 Göttingen) die Tastkörperchen (Meißner-Körperchen) der Haut (FREUDIG, 1996 a). Mit Wagner hielt Friedrich Wilhelm Beneke von 1848 bis kurz vor dessen Tod brieflichen Kontakt.
Konrad Johann Martin Langenbeck
(1776 - 1851)
Rudolph Wagner
(1805 - 1864)
Der Mediziner Konrad Heinrich Fuchs (07.12.1803 Bamberg - 02.12.1855 Göttingen) habilitierte sich 1831, wurde 1833 Professor für Pathologie an der Universität Würzburg und wirkte ab 1838 als Leiter der Medizinischen Poliklinik an der Universität Göttingen. Ab 1853 übernahm Fuchs die Leitung der Medizinischen Klinik. Er gab eine systematische Beschreibung des Ergotismus heraus (Vergiftung durch „Mutterkorn“, Secale cornutum). Ferner befaßte er sich mit der Geschichte und Epidemiologie von Scharlach, Angina maligna und Krupp (FREUDIG, 1996 b).
Der Botaniker August Heinrich Rudolf Grisebach (17.04.1814 Hannover 09.05.1879 Göttingen) studierte Medizin und Naturwissenschaften von 1832 bis 1834 in Göttingen, danach in Berlin. Er promovierte 1836 mit einem Thema aus der Botanik und wurde 1841 Professor für allgemeine Naturgeschichte an der medizinischen Fakultät in Göttingen. Zwischen 1839 bis 1852 unternahm er Reisen in die Türkei, Norwegen, Pyrenäen und Siebenbürgen. Er gilt mit seinem zweibändigem Werk „Die Vegetation der Erde nach ihrer klimatischen Anordnung“ (1872), in dem Grisebach 24 Florengebiete beschrieb, neben dem Schweizer Botaniker Alphonse-Pyrame de Candolle (27.10.1806 Paris - 14.04.1893 Genf) als der Begründer der Pflanzengeographie (FREUDIG, 1996 c).
Der Pathologe und Internist Friedrich Theodor von Frerichs (24.03.1819 Aurich 14.03.1885 Berlin) wirkte ab 1848 als Professor in Göttingen, Kiel, Breslau und ab 1858 in Berlin. Er forschte über den Proteinstoffwechsel und entdeckte im Harn die Aminosäuren Leucin und Tyrosin. Weiterhin beschäftigte sich Frerichs mit den Stoffwechselstörungen der inneren Organe, insbesondere Niere, Leber und Bauchspeicheldrüse, zu denen er bedeutende Beiträge lieferte. Frerichs schrieb 1861 auch das erste moderne Lehrbuch der Hepatologie (Teilgebiet der inneren Medizin, das sich mit den Erkrankungen der Leber- und Gallenwege beschäftigt). Mit dem Mediziner Ernst Viktor von Leyden (20.04.1832 Danzig - 05.10.1910 Berlin) begründete Frerichs 1880 die „Zeitschrift für klinische Medizin“ (FREUDIG, 1996 d).
August Heinrich Rudolf Grisebach
(1814 - 1879)
Friedrich Theodor von Frerichs
(1819 - 1885)
Der Mediziner und Gynäkologe Eduard Kaspar Jakob von Siebold (1801 Würzburg - 1861 Göttingen) entstammte einer alten Würzburger Gelehrtenfamilie. Eduard von Siebolds Großvater, der Stammvater der Ärzte- und NaturforscherDynastie der „Würzburger Siebolds“, war Carl-Caspar von Siebold (1736 - 1807), Professor der Anatomie und Chirurgie, Oberwundarzt und Hebammenmeister in Würzburg. Seine vier Söhne wurden allesamt Mediziner, drei davon Professoren in Würzburg. Eduard Kaspar Jakob von Siebold studierte Medizin in Berlin wohin sein Vater Elias von Siebold 1816 einen Ruf an die Universität und als Leiter einer Klinik erhalten hatte. Im Jahre 1827 habilitierte er sich ebenfalls in Berlin und wurde. 1829 wurde Eduard Kaspar Jakob von Siebold nach Marburg berufen wo er als Professor der Geburtshilfe und Direktor der Entbindungsanstalt und als Hebammenlehrer wirkte. Bereits 1833 wurde er an die Universität Göttingen berufen, wo er die Leitung der Universitätsfrauenklinik bis zu seinem Tod übernahm. Während eines Aufenthaltes in Wien (1847) lernte er auch Ignaz Philipp Semmelweis (01.07.1818 Ofen, heute Teil von Budapest - 13.08.1865 Döbling, heute Wien) kennen, dessen Anschauung über Genese und Prophylaxe des Puerperalfiebers (Kindbettfieber) er sich jedoch nicht anschließen konnte. Das 1847 von James Young Simpson (07.06.1811 Bathgate bei Edinburgh - 06.05.1870 Edinburgh) eingeführte Chloroform zur Anästhesie führte von Siebold umgehend in die klinische Praxis ein. So wurde 1853 erstmals unter seiner Leitung ein Kaiserschnitt in Anästhesie durchgeführt. Unter seiner Leitung wurden schließlich auch die Frauenkrankheiten einbezogen, so daß die Geburtsklinik zur Frauenklinik avancierte. Aus den hier tätigen Geburtshelfern wurden Frauenärzte.
Der Mediziner (Karl) Julius Vogel (25.06.1814 Wunsiedel/Franken - 07.11.1880 Halle) war erst Kaufmann. Ab 1833 studierte er Medizin in München, wo er auch 1838 mit der Dissertation „Sputorum elementa chemica et microscopia“ promovierte. 1840 habilitierte, er sich in Göttingen und wurde 1842 Mitdirektor des physiologischen Instituts neben Rudolph Wagner. 1846 wurde Vogel Direktor der Medizinischen Klinik an der Universität Gießen, 1855 an der Universität Halle. Im Jahre 1861 erhielt er eine Professur der pathologischen Anatomie an der Universität Halle, wo er 1873 aus Gesundheitsgründen emeritiert wurde. Vogel war ab 1854 Mitredakteur der Schriften des „Archivs des Vereins für gemeinschaftliche Arbeiten zur Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde“, dessen Redaktion Friedrich Wilhelm Beneke innehatte.
Eduard Kasper Jakob von Siebold
(1801 - 1861)
(Karl) Julius Vogel
(1814 - 1880)
Der Chemiker Friedrich Wöhler (31.07.1800 Eschersheim, heute Frankfurt a. M. 23.09.1882 Göttingen) studierte erst Medizin in Marburg und Heidelberg und promovierte 1823 zum Dr. med. Danach wandte er sich endgültig der Chemie zu und arbeitete 1823/24 bei Jöns Jacob Berzelius (20.08.1779 Väversunda Sörgard 07.08.1848 Stockholm) in Stockholm. Wöhler arbeitete ab 1825 an der Gewerbeschule in Berlin wo er 1828 Professor wurde und wirkte ab 1831 an der Gewerbeschule in Kassel. 1836 wurde Wöhler Professor der Chemie und Pharmazie an der Universität Göttingen. Er war gleichzeitig Direktor des chemischen Laboratoriums der Medizinischen Fakultät und Generalinspektor des Apothekenwesens im Königreich Hannover. Wöhler und Justus Freiherr von Liebig (12.05.1803 Darmstadt - 18.04.1873 München), mit dem er intensiv zusammenarbeitete, gelten als Begründer der modernen Chemie. Wöhler synthetisierte 1828 erstmals eine organische Substanz (Harnstoff) aus einer anorganischen (Ammoniumcyanat) und widerlegte damit das Konzept einer „Lebenskraft“. Wöhler arbeitete unter anderem über Benzoesäure, Amygdalin, Opiumalkaloide, Siliciumwasserstoffe und stellte erstmals eine große Anzahl organischer Verbindungen wie z. B. Iodcyan, Cyansäure (1830) und Hydrochinon (1843) dar; dabei entdeckte er auch die Isomerie von Cyan- und Knallsäure. Weiterhin konnte Wöhler metallisches Aluminium durch Reduktion mittels Kalium (1827) herstellen. 1828 stellte er Beryllium und Yttrium her, 1856 kristallines Silicium. Er klärte 1838 die Natur der Harnsäure und isolierte 1860 das Cocain. Wöhler entdeckte 1862 das Calciumcarbid und schuf damit die Grundlage für die Acetylenherstellung auf Kohlebasis. Außerdem verwendete er Metalloxide als Katalysatoren und untersuchte chemische Reaktionen bei Anwendung hoher Temperaturen und Drücke. Mit Liebig gab er ab 1838 die „Annalen für Chemie und Pharmacie“ heraus
(FREUDIG, 1996 e).
Der Mediziner, Anatom und Physiologe Ernst August Wilhelm Himly (14.12.1800 Braunschweig - 16.02.1881 Göttingen). Sein Vater war der Mediziner und Ophthamologe, der erst in
Braunschweig (1795), dann in Jena (1801) und ab 1803 in Göttingen wirkende Carl Gustav Himly (30.04.1772 Braunschweig - 22.03.1837 Göttingen). Letzterer starb unter mysteriösen
Umständen in der Leine. Ernst August Wilhelm Himly studierte Medizin in Göttingen war erst Professor der Augenheilkunde in Jena und ab 1832 in Göttingen.
Der Stiefbruder von Ernst August Wilhelm Himly war der Physiker und Chemiker August Friedrich Carl Himly (26.11.1811 Göttingen - 26.(27).01.1885 Döbling bei Wien, heute Wien XIX.
Bezirk) seit 1842 außerordentlicher Professor für Physik in Göttingen, ab 1846 Ordinarius der Chemie an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Er war der Schwager von Werner von Siemens
(23.12.1816 Lenthe bei Hannover - 06.12.1892 Charlottenburg). Bei diesem August Friedrich Carl Himly hörte Friedrich Wilhelm Beneke Vorlesungen der Physik in Göttingen.
Carl Himly und Werner von Siemens taten sich gemeinsam 1848 in der Festung Friedrichsort bei der Verteidigung von Kiel gegen dänische Kriegsschiffe im Ersten Schleswigschen Krieg (1848 - 1851)
hervor. Diese Festung war in dänischer Hand und wurde von der schleswig-holsteinischen Truppe erobert. Sie verlegten in der Förde Kabel (ähnlich wie Seekabel für Telegraphen), an dem Seemienen
befestigt waren, die von der Festung aus gezündet werden konnten. Es wurden auch Kontakte verlegt, um die Minen bei Berührung mit durchbrechenden Schiffen zu zünden. Durch Unachtsamkeit
explodierte eine dieser Minen an Land, was den Dänen nicht unbemerkt blieb. Diese im Volksmund „Himlybomben" und „Mine Himly“ genannten Seeminen erfüllten ihre abschreckende Wirkung; kein
dänisches Kriegsschiff versuchte, nach Kiel einzulaufen (Beneke K, 1997, Beneke K, 2005)
Der Mediziner, Pathologe und Historiker Karl Friedrich Heinrich Marx (10.03.1796 Karlsruhe - 02.10.1877 Göttingen) studierte ab 1813 in Heidelberg, später in Wien und promovierte
1820 in Jena. Danach begann er eine Tätigkeit an der Universitäts-Bibliothek in Göttingen und erhielt 1822 die Genehmigung, Vorlesungen zu halten. 1826 wurde Marx außerordentlicher, 1931
ordentlicher Professor an der Universität Göttingen mit den Lehrfächern Geschichte der Medizin, ferner allgemeine und spezielle Pathologie und später Arzneimittellehre. Marx wurde 1840 zum Hofrat
ernannt. Im wesentlichen veröffentlichte er auf dem Gebiete der Geschichte der Medizin.
Der Mediziner und Augenheilkundler Christian Georg Theodor Ruete (02.05.1810 Scharenbeck bei Bremen - 23.06.1867 Leipzig) studierte in Göttingen Medizin und promovierte dort 1833. Danach war er Assistent bei Carl Gustav Himly und wurde 1837 Privatdozent. 1841 wurde er außerordentlicher Professor, ab 1847 ordentlicher Professor für Augenheilkunde sowie für allgemeine Pathologie und Therapie und Arzneimittellehre an der Universität Göttingen. Ruete wechselte 1852 auf die Stelle eines Ordinarius für Augenheilkunde und wurde ab 1853 gleichzeitig Leiter der Medizinischen Poliklinik in Leipzig.
Der Philosoph Rudolph Hermann Lotze (21.05.1817 Bautzen - 01.07.1881 Berlin). Nach dem Studium in Leipzig lehrte Lotze dort von 1838 bis 1844 Medizin und Philosophie. Danach
wirkte er als Professor an der Universität Göttingen und kurz vor seinem Tod 1881 in Berlin. Lotze versuchte durch eine eigentümliche Verbindung von Kantianismus und Leibnitzscher Monadologie
eine Synthese von Naturwissenschaften und christlicher Religion zu erreichen. Die Wirklichkeit, Resultat der Wechselwirkung beseelter Monaden, konnte nach Lotze in immer neue, durch wechselnde
Gesetze getragene Zusätze eingehen, wobei die logischen Gesetze als ewig anzusehen waren, die in der Sphäre des Gütigen wurzeln. Lotze wandte sich gegen jede Art von Psychologismus in der Logik,
die für ihn, auch Themen aus der Methodologie und der Erkenntnistheorie umfaßt (Kreiser, 1990).
Diese akademischen Lehrer führten Friedrich Wilhelm Beneke in ihre jeweiligen Fachgebiete ein. Das Göttinger Studentenleben machte er ebenso mit wie das Erleben musikalischer Ereignisse. Als
Student hatte F. W. Beneke 1845 an der von der medizinischen Fakultät Göttingen ausgeschriebenen Preisaufgabe zur Untersuchungen über Mißbildungen teilgenommen. Zwei Freunde und Zimmernachbarn
Rudolf Karl Georg Friedrich Leuckart (07.10.1822 Helmstedt - 06.02.1898 Leipzig) und F. W. Beneke erhielten den Preis. Diese prämierte Arbeit konnte F. W. Beneke in erweiterter Fassung als
Dissertation einreichen.
Am 17. Januar promovierte Friedrich Wilhelm Beneke mit der Dissertation „De ortu et causa monstrorum disquisitio“ (Untersuchung über Entstehung und Ursachen von Mißbildungen) (Beneke, 1846) zum
„Dr. Medicinae, Chirurgiae et Artisque Obstetriciae“ (Doktor der Medizin, der Chirurgie und der Geburtshilfe (eigentlich: Artisque Obstetriciae - und der Hebammenkunst). Die Arbeit widmete F. W.
Beneke seinen beiden akademischen Lehrern, Conrad Heinrich Fuchs und Eduard Kasper Jakob von Siebold. In dieser Arbeit geht es um Vererbungslehre und im engeren Sinne um die Entstehung und
Ursachen von Mißbildungen, wie der Titel aussagte. F. W. Beneke stellte fest, daß Mißbildungen Folgeerscheinungen von Prozessen sind, die unter der Geburt und in der Embryonalzeit unter dem
Einfluß physiologischer und mechanischer Gesetze ablaufen. Dabei war er bestrebt, Denkanstöße zu geben zur Erkennung allgemein gültiger Gesetzmäßigkeiten, unter denen Mißbildungen auftreten
konnten.
Die Promotion weckte bei F. W. Beneke den Willen zur wissenschaftlichen Arbeit. Er ging für ein Semester an die Universität Prag, um seine Studien zu vertiefen, bevor er im November 1846 an der
Universität Göttingen sein medizinisches Staatsexamen ablegte. In Prag lehrten u. a. Johann Ritter von Oppolzer, Franz Freiherr von Pitha und Anton Jaksch, Ritter von Wartenhorst. Dort hatte sich
die genaue Beobachtung in der Medizin voll durchgesetzt, was F. W. Beneke als Fortschritt gegenüber der „naturhistorischen" Medizin in Göttingen empfand. Er erwarb sich außerdem durch
Privatstudien Kenntnisse der gesamten physiologischen Chemie.
Friedrich Wilhelm Benekes Lehrer in Prag waren:
Der Mediziner Johann Oppolzer, ab 1869 Ritter von Oppolzer (04.08.1808 Gratzen in Böhmen - 16. 04.1871 Wien) studierte in Prag Medizin, wo er 1835 promovierte. Zunächst war er
Assistent an der Medizinischen Klinik des Allgemeinen Krankenhauses in Prag; 1839 habilitierte er sich dort. Von 1839 bis 1840 war er als praktischer Arzt in Prag tätig und wurde 1840 bis 1848
Direktor und Ordinarius der Medizinischen Klinik in Prag. Von 1848 bis 1849 wirkte Oppolzer als Direktor und Ordinarius der Medizinischen Klinik in Leipzig. Ab 1859 bis zu seinem Tode im Jahre
1871 war er Direktor und Ordinarius der zweiten Medizinischen Klinik in Wien. Oppolzer erlangte große Bedeutung als Kliniker, indem er eine ganzheitliche Diagnose und Therapie in der alten Wiener
Schule begründete. Er vertrat die physiologische Heilkunde im Gegensatz zur symptomatischen Pathologie. Neben wissenschaftlicher Forschung, Diagnosestellung und Sektion betonte er die Bedeutung
des Heilens in der Medizin. Oppolzer war außerdem ein Förderer der Balneologie, Elektrotherapie, Wasserheilkunde und Diätetik.
Der Chirurg Franz Pitha, später Freiherr von Pitha (08.02.1810 Rakom in Böhmen - 29.12.1875 Wien) studierte ab 1830 Medizin in Prag und promovierte dort 1836 zum Dr. med. und 1837 zum Dr. Chir. Von 1836 bis 1837 war er Assistent an der Zweiten Chirurgischen Klinik und als Secundar-Chirurg im Prager Allgemeinen Krankenhaus tätig. Von 1838 bis 1841 war er Assistent an der Chirurgischen Klinik der Universität Prag, die unter der Leitung von Ignaz Franz Fritz (1778 - 1841) stand. Im Jahre 1843 wurde Pitha zum Leiter der Chirurgischen Klinik der Universität Prag als Nachfolger von I. F. Fritz ernannt. Diese Stelle hatte er bis 1857 inne. In dieser Zeit wirkte er zwischenzeitlich auch als Primär-Chirurg und Gerichts-Wundarzt des Strafhauses in Prag und unternahm eine längere wissenschaftliche Reise durch Europa.
Im Jahre 1857 wurde Pitha zum Professor der Chirugie und Leiter der Chirurgischen Klinik an der medizinisch-chirurgischen Josephs-Akademie in Wien ernannt. In den folgenden Jahren war er auch als
Feldarzt tätig, und übernahm ab 1866 die Leitung des Feldsanitätswesens und der Feldspitäler.
Anton Jaksch, Ritter von Wartenhorst (11.04.1810 Wartenberg in Böhmen - 02.09.1887 Prag) studierte Medizin in Prag und Wien und promovierte 1835. Von 1835 bis 1838 wirkte er als
Assistenzarzt an der Klinik der Wundärzte (ab 1854 Zweite Medizinische Klinik) in Prag. Von 1842 bis 1846 führte er den Vorsitz und war Dozent an der Brustkrankenabteilung in Prag. Jaksch
übernahm von 1846 bis 1849 die Leitung der Klinik der Wundärzte in Prag und wirkte ab 1849 als Leiter und Ordinarius der Ersten Medizinischen Klinik in Prag bis 1881.
(Die Erste Medizinische Klinik, deren Leitung Anton Jaksch von 1849 bis 1881 inne hatte, fiel 1882 an die Böhmische Fakultät, als diese von der Deutschen Fakultät getrennt wurde. Die Zweite
Medizinische Klinik, an der Anton Jaksch als Assistent und von 1846 bis 1849 als Leiter tätig war, ehemals Klinik der Wundärzte, wurde 1854 Zweite Medizinische Klinik, ab 1883 Erste Deutsche
Medizinische Klinik).
Friedrich Wilhelm Beneke mußte noch nicht, so wie es heute zum festen Bestandteil studentischer Tradition in Göttingen geworden ist, nach der Promotion die Bronzestatue der Gänseliesel küssen.
Der Gänseliesel-Brunnen, ein Jugendstilwerk von Paul Nisse, wurde erst 1901 vor dem alten Rathaus gebaut.
Das Gänseliesel ist das „meistgeküßte Mädchen der Welt". Jeder Doktorand, der sein Examen bestanden hat, muß ihm einen Kuß aufdrücken. Diese Freiheit erlaubten sich die Studenten, weil sie eine
erkleckliche Summe zur Anschaffung der Brunnenfigur beigesteuert hatten. Aber 1926 wurde dem Göttinger Rat der Wirbel zu bunt, und er erließ ein „Kußverbot“. Ein Student klagte dagegen beim
Berliner Kammergericht und verlor. Trotzdem wurde weiter geküßt, und inzwischen hat längst niemand mehr etwas dagegen. Beim Besteigen des Gänseliesels-Brunnens kommt es immer wieder mal vor, daß
Doktoranden, bevor sie ihr Ziel erreichen um die Gänseliesel zu küssen, in den Brunnen fallen.
Celle
Friedrich Wilhelm Beneke stellte im Dezember 1846 einen Antrag zur Ausübung als praktischer Arzt in seiner Vaterstadt Celle. In einem Schreiben (Schmitter, 1986) an den Magistrat zu Celle schrieb
die Königlich Hannoversche Landvogtei Lüneburg:
„No 16192 31. Dezember 1846
949
Auslage - 15 M 3 G
Der Dr. med Friedrich Wilhelm Beneke alldort hat in der sub´lege remish. angeschlossenen Eingabe de praes: 21. d. M., um Zulassung zur ärztlichen und wundärztlichen Praxis in der Stadt Celle nachgesucht. Es werden die eine Zulassung zur ärztlichen Praxis beschränkten Bestimmungen der Verordnung vom 18. Dezbr. 1818, namentlich auch so weit sie auf ein vorhandenes Bedürfniß sich beziehen, auf die dortige Stadt, da dieselbe zu den größeren im Sinne des P. 4. der Verordnung zu rechnen ist, zwar keine Anwendung finden.
Vor weiterer Verfügung wünschen Wir jedoch von dem löblichen Magistrate baldthunlichst noch zu vernehmen, ob etwa besondere Gründe eintreten, um den Dr. med. Beneke die
Erlaubniß zur ärztlichen Praxis in dortiger Stadt zu verweigern.
Lüneburg den 28. Dezbr. 1846
Königlich hannoversche Landvogtei
Jo-Dornegns“
Der Magistrat zu Celle antwortete der Königlich Hannoversche Landvogtei am 6. Januar 1847 in einem Schreiben (Schmitter, 1986):
„Ad. No 16192 de 1846
An K. h. Landesvogtei Lüneburg
Bericht
des Magistrats der Stadt Celle
vom 6.Januar 1847
die (...)
des Dr. med Beneke betreffend
Hat zur Anlage rückgehenden Gesuch mit Anlagen. Dem (...) vom 28./31. vorigen Monats zufolge berichten wir über das Gesuch des Dr. med. Beneke um (...) zur Ausübung der ärztlichen und
wundärztlichen Praxis in hiesiger Stadt gehorsamst, daß wir besondere Gründe, weshalb ihm die nachgesuchte Erlaubniß zu versagen, anzugeben nicht vermögen, wenn solche nicht aus
dem Umstand, daß es hier an Aerzten und zwar an ausgezeichneten, nicht fehlt, daher einem jungen in die Praxis erst eintretenden Manne, sehr schwer werden muß, in Thätigkeit zu kommen, zu
entnehmen sind, daß es ihm, davon abgesehen, seiner persönlichen Verhältniße wegen, er ist der Sohn des hiesigen Kanzlei ´Secretärs Beneke, wünschenswerth sein muß, hier seine practische Laufbahn
zu beginnen, noch Zeit und Gelegenheit ein angemeßeneres Feld der Thätigkeit von hier aus zu finden; daß uns (...) mitgetheilte Gesuch des Bittstellers senden wir mit den Anlagen hier neben
gehorsamst zurück.
M. D. St. Celle
L. T. Schl.
Dem Dr. med. Beneke allhier eröffnen wir, daß der von K. Landvogtei über dessen Gesuch, seine Niederlaßung hiesiger Stadt als practischer Arzt betreffend, unter dem 28/31 vor. Monats (...)
Bericht, vom heutigen Tage erstattet ist
Beschl. Celle den 6. Januar 1847
M. d. St. Celle
(...)
Auslage 15 (gm) 3 ch
Bericht 16 (gm)
Copie 4 (gm)
Bestallung 4 (gm)
(...) 15 (gm) 3 ch“
Die Königliche Hannoversche Landvogtei schrieb am 15. Januar 1847 in einem Schreiben (Schmitter, 1986) an den Magistrat zu Celle und Friedrich Wilhelm Beneke:
„Kgl. Hannov. Landvogtei -
(für Magistrat zu Celle)
Lüneburg, 15. Jan. 1847
An den
Herrn Dr. med. Friedr.
Wilhelm Beneke zu Celle
Abschrift
für den Magistrat Celle
No 544
Adacta
Januar 1847
Sch.
Auf das unterm 21. v. M. hier eingegangene Gesuch, dessen Anlagen hieneben zurückgehen, wollen Wir dem Herrn Doctor der Medizin die Erlaubniß zur Ausübung der Heilkunst mit Einschluß der
Geburtshülfe und der Chirugie unter Niederlassung zu Celle hiermit ertheilen.
Lüneburg den 15. Jan. 1847
Koenigliche Landvogtei“
Somit erteilte im Januar 1847 die Königliche Landvogtei Lüneburg sowie der Magistrat der Stadt Celle F. W. Beneke die Erlaubnis, sich in seiner Vaterstadt Celle als praktischer Arzt
niederzulassen. Dabei wurde aber daraufhingewiesen, daß es bereits gute Ärzte in Celle gab. Es wurden Bedenken geäußert, ob es dem jungen unerfahrenen Arzt gelingen würde „in Thätigkeit zu
kommen“. Der Magistrat zog zumindest in Erwägung, ob sich F. W. Beneke in der Stadt Celle eine dauerhafte Existenz, wohl besonders in finanzieller Hinsicht, gründen könne. Man ging aber davon
aus, daß es ihm als Sohn des Kanzlei-Sekretärs Georg August Beneke wünschenswert wäre, hier seine praktische Laufbahn als Arzt zu beginnen. F. W. Beneke arbeitete in seiner Vaterstadt Celle
schließlich als Armenarzt (Beneke R., 1929; Schmitter, 1986).
Es folgten die ersten Publikationen (Beneke, 1847 a, b): Außer mit seiner Praxis beschäftigte sich der junge Arzt F. W. Beneke auch mit anderen Problemen. Angeregt durch Justus von Liebigs
Agrikulturexperimente machte er sich Gedanken über die Ernährungsverbesserung durch phosphorsauren Kalk und Stoffwechselfragen. Durch Schaffung einer „rationell“ chemischen Therapie trat er mit
Liebig in schriftliche Verbindung (Beneke R., 1939; Schmitter, 1986).
Friedrich Wilhelm Beneke schrieb am 12. August 1847 einen ersten langen Brief an Justus von Liebig (Schmitter, 1986):
„Hochgeehrtester Herr Professor!
Wenn ich es unbekannter Weise wage, mich schriftlich an Sie zu wenden, so laßen Sie mich in dem großen Intereße, welches ich für unsere Wißenschaft hege, eine Entschuldigung finden, es ist
eben dieses Intereße, welches mir die Feder in die Hand giebt u[nd] um Sie um einen Rath, vielleicht auch um einen Beistand durch die That zu ersuchen.
Die großen Mängel unseres medicinischen Wißens, die ich, als ich noch mit der Theorie beschäftigt war, schon tief empfand, habe ich seit einem Jahre in der Praxis kennen zu lernen begonnen!
Ich war bemüht mir das zu eigen zu machen, was in der neuen Zeit für die praktische Medicin gewonnen wurde. Dennoch empfinde ich stets tiefe Leiden; Pathogenese [Entstehungsweise krankhafter
Prozesse], Therapie liefern mir tägliche Fragen, deren Beantwortung zur Zeit unmöglich ist. Die Aufkärung über diese erwarte ich zum größten Theil von der Chemie. Dieser Erwartung gemäß
beschäftige ich mich seit geraumer Zeit fast lediglich mit chemischen Studien und die höchst intereßanten, erregenden Aufschlüße, die ich schon früher aus Ihren Werken erlangte, verfolge ich mit
viel Eifer. Ich bin nun zu der Einsicht gelangt, daß wir die normalen physiologischen Proceße, geschweige denn die pathologischen nicht alsogleich durch Studien unseres Organismus selbst
begreifen lernen; ich habe einen anderen Weg eingeschlagen, und bei den Pflanzen und mit den Thieren begonnen, um von dem Einfachen zum Complicirten fortschreiten zu können. Ich habe mich so dann
zunächst zur Humoralpathologie [Krankheitskonzept, wonach Gesundheit und Krankheit Ausdruck einer regelrechten (Eukrasie) oder falschen (Dyskrasie) Mischung der Körpersäfte sind] diesem Postulate
des praktischen Vergleichs, wie Rokitansky [Karl Freiherr von Rokitansky, österreichischer Pathologe (1804 - 1878)] so richtig sagt, gewandt; jedoch so viel ich darüber studiert, die (Andral.
Gavarretische, Wundalito, Zimmernno) u. A. Arbeiten, sie sind zum Theil unbrauchbar, so viel sie auch bieten, sie sind dennoch zum Theil einseitig. Es ist in der That unbegreiflich, wie man sich
beim Studium pathologischer Proceße immer nur mit den organischen Stoffen beschäftigen und die unorganischen so gänzlich vernachläßigen konnte, die einzigen Angaben über dieselben von Berguerel
u[nd] Rodier scheinen mir ungenau und sind in der Theorie der selben auch fast ganz unberücksichtigt gelaßen. Je weiter ich kam, desto dringender wird mir das Bedürfnis nach meiner Einsicht in
die Verhältniße der unorganischen Stoffe unseres Organismus, und ich wage die Vermuthung auszusprechen, daß die qualitativen Abnormitäten der organischen Bestandtheile, auf die Roc (...) durch
seine nüchterne Beobachtung hingeführt wurde und den einen so wichtigen Theil der C[ellen]lehre bilden; zu größten Theil auf einen abnormen Verhältniß jener anorganischen Bestandtheile beruhen. -
Sie haben mit Gewißheit nachgewiesen, daß die Erzeugung organischer Stoffe im engsten (...) zur Gegenwart anorganischer Bestandtheile im Pflanzenreiche stehen, so wie daß die Erzeugung
stickstofffreier Stoffe, die [Gegenwart] der Alkalien, die Entstehung stickstoffhaltiger Stoffe das Vorhandensein alkalischer Erden, insonderheit des phosphorsauren Kalkes erfordern.
Ihr Schüler Dr. C. Schmidt, den ich mich freute in Göttingen kennen zu lernen, hat sodann mit fast unzweifelhafter Gewißheit in seinem kleinen Schriftchen „zur vergleichenden Physiologie der
(...)“ so wie in seinem Entwurf zur allgemeinen Untersuchung der (...) u[nd] Säfte des Organismus, ermittelt, daß der phosphorsaure Kalk in unmittelbarer Beziehung zum Zellenbildungsprozeße im
thierischen Organismus stehe. - Wißen wir nun daß Fibrin und Albumin (...) auch in unserem Organismus von phosphorsaurem Kalk begleitet sind, so scheint es mir, als ob wir auch hier in ihm einen
Vermittler des Zellenbildungsprozeßes sehen dürften und ich möchte dennoch im thierischen Haushalt den doppelten Endzweck die Theilnahme vom Zellenbildungsprozeß und von der Bildung der Knochen
zuschreiben, daß auch die Alkalien eine wichtige Rolle spielen, scheint mir eben so unzweifelhaft; und wie in den Pflanzen zur Entstehung der Pflanzenfasern, des Zuckers und Amylon u. s. w. so
möchten sie vielleicht im thierischen Organismus auf ähnliche Weise zur Heranbildung des Sauerstofffreien Fettes aus Zucker, Amylon u. s. w. dienen. Das Entweichen gewißer Aequivalente Waßer oder
deßen einzelner Elemente scheint mir, wie Lehmann in seiner physiolog[ischen] Chemie im Capitel im Pflanzenreich, es nachzuweisen sucht, wesentlich an die Gegenwart von Alkalien gebunden zu sein,
das Verhalten der s[o] g[enannten] Proteinverbindungen zu Alkalien ist außerdem bekannt, kurz, daß sie sehr wesentlich sind, bezweifle ich keinen Augenblick, wenn mir auch das Weiß und Warum?
Noch nicht ganz klar ist. Intereßant waren mir bei der Durcharbeitung dieser Gedanken die Untersuchungen von (...) wie 49st und 50st Ihrer Annalen, wünscht [empfand] ich [E]inige seiner Angaben
bei angestellten Versuchen nicht bestätigt fand und (...) seine Untersuchungen noch zu vereinzelt sind, als daß sie schon allgemeine Schlußfolgerungen gestatteten, zu[m] B. müßte die Entscheidung
der wichtigen Frage nach den quantitativen Verhältnißen des phosphorsauren Kalkes im Blute und Muskelfleisch noch dahingestellt bleiben! Eine Menge andrer Aufsätze, die ich in Ihrem Annalen fand,
haben mir höchst intereßante Anhaltspunkte verschafft und ob ich mich auch irre, oder nicht, ich weiß es nicht, ich kann mich der ausgesprochenen Ansicht nicht entsagen, daß wir in
humoralpatholpgischen Prozeße keine Einsicht bekommen, ohne genaue Kenntniß der anorganischen Bestandtheile des Blutes. Es stellen sich demnach für die praktische Medicin zwei Aufgaben, einmal
die Untersuchung, wie sich in normalen wie pathologischen Blute die anorganischen Bestandtheile neben den zum größten Theil bekannten organischen verhält, und zweitens insofern wie ein normales
Blut nur bei genauer Kenntniß der Nahrungsmittel heranbilden können, die Frage, wie qualitativ und quantitativ die Arthen unsrer verschiedenen Nahrungsmittel zusammengesetzt sind, Horoford´s und
Amler Untersuchungen haben uns über das Verhalten der organischen Stoffe schon genaue Kenntniß verschafft. –
Daß Sie, hochgeehrtester Herr Professor, solche Untersuchungen veranlaßen möchten, ist es, warum ich Sie ersuchen möchte, wenn anders natürlich sie Ihnen werthvoll scheinen. Ich habe leider
früher die Gelegenheit, von Fertigkeit in praktischen, chemischen Arbeiten zu erwerben, vorübergehen laßen, suche jedoch mit Beihilfe eines tüchtigen Chemikers, des Herrn Beg. Commissair
Rottmann, Apotheker seinselbst, das Versäumte nachzuholen, und werde mich mit jenen Arbeiten, so viel meine Zeit erlaubt, beschäftigen. Allein ich sehe im Voraus, wenn die Zeit ist nicht
ausreichend dazu, selten kann ich ein paar Stunden verhaltend bei einer Analyse beschäftigt sein; darf ich dazu die Hoffnung hegen, daß die Praxis, der ich mich für jetzt nun einmal gewidmet
habe, vergrößert, so wird mir vollends keine Zeit bleiben. Ich muß also, und so wird es allen praktischen Aerzten gehen, auf fremde Beihilfen rechnen!
Daß ich übrigens in der Praxis selbst schon bemüht bin, meine Ansichten zu prüfen, darf ich vielleicht noch mit wenigen Worten hinzufügen. - Wir haben hier, um nur eins zu erwähnen, viel mit
Scropheln zu kämpfen und der auf ihrer Basis erhebenden Tuberculose, meistens der Lunge, sehen wir viele Opfer fallen. Ich halte nun eben dafür, daß wir in den bei der Srcophulose und Tuberculose
abgelagerten, unorganischen Maaßen Stoffe sehen müßen, die sich qualitativ abnormen Bildungsmaterial entsprungen, lediglich deshalb abgelagert wurden, weil es an Stoffen Fehlte, die zur
Ueberführung des Materials zu organisirten Gewebe dringend erforderlich sind; ich rechne zu diesen Stoffen, wie ich eben aussprach den phosphorsauren Kalk [Skrofulose; historischer Begriff, der
mit der Disposition zur Tuberkulose in Zusammenhang gebracht wurde (exsudative Diathese). Heutige Existenzberechtigung als Krankheitsbegriff ist fraglich].
Ich habe ihn also gereicht und in der That , ich bin ein paar Mal durch die, ich will sagen scheinbare, Wirkung frappiert, ich fürchte mich jedoch noch vor dem (post hoc), ergo propter hier.
–
Ein Kind hatte ein scrophulöses Geschwür mitten auf dem Kopf, das durchaus nicht zum Verheilen zu bringen war; es war dasselbe schon länger von einem andern Arzte behandelt, ich selbst hatte
es im Winter die gewöhnlichen Antiscroph(...) gebrauchen laßen, doch Alles war vergeblich, seit ¼ Jahre hatte ich das Kind nicht wieder gesehen. Ich suchte das Kind jetzt wieder auf und fand das
Geschwür noch etwas vergrößert; ich reichte sofort Calcaria phosphorica (gr.-/gr.); vor all daß Täglich zweimal, Pulver und zwar stets unmittelbar nach dem Eßen, damit der Kalk durch das Alb
(...) u. s. w. möglichst gelöst werde. 3 Wochen wird das Kind jetzt auf diese Weise behandelt und ich bin erstaunt das Geschwür verheilen zu sehen. Ein andres scrophulöses Kind litt an einem sehr
ausgesprochenen Fa(vus), zwei großen Stellen, die sich immer wieder mit Knöten bedeckten, waren nicht zum Verheilen zu bringen, jetzt nach Anwendung des Kalkes ist die Heilung gelungen. Ein Knabe
litt an einer Gonarthrocarce; das Leiden schwindet mit erstaunlicher Schnelligkeit, die sehr angeschwollenen Knie verdünnen sich merklich u. s. w. nach Anwendung Kalks; doch ist diese Beobachtung
nicht rein, der der Kranke auch Ol jev Thett nimmt und ihm örtliche Fontanellen appliciert sind. Ueberhaupt gebe ich auf meine Beobachtungen noch gar nichts und bis auch mehrere Beobachtungen
belehren, will ich gerne glauben, daß ich mich täusche.- Sehr intereßant waren mir in Beziehung zum letzten Falle die Untersuchungen von Bibra´s in Ihren Annalen B[an]d 57.-
Ich mag Sie, hochgeehrtester Herr Professor, mit weiteren Beobachtungen u[nd] Auseinandersetzungen nicht beläßtigten, nur einen Punkt, der mich sehr intereßirte, möchte ich noch hinzufügen.
Aus einigen Ihrer und Bonosingaulter Angaben berechnete ich nämlich den Gehalt der Alkalien und alkalischer Werte von Roggenmehl, Weizenmehl und Kartoffeln. Ich fand, daß der Gehalt an
phosphorsaurem Kalk im Weizen positiv u[nd] relativ bei weitem größer ist, als im Roggen u[nd] Kartoffeln; dies aber sind zwei Stoffe, die die Empirie lange schon bei Scrophulosis verbietet. Die
mit Recht viel gerühmte Wirksamkeit des Leberthemas bei diesem Leiden die Prof. Knapp in Ihren Annalen B[an]d 58 nach meiner Meinung richtig würdigt, stelle ich durchaus nicht in Abrede; doch
scheint mir dieselbe sehr oft nicht nachhaltig zu sein. Es würde zu weit führen wollte ich mich hier weiter darüber auslaßen. - Ich führte in möglichster Kürze hier nur einen Kranheitsprozeß an,
um zu zeigen, wie u[nd] wo ich eine neue Ansicht gewonnen zu haben glaube. Das tiefere und gewiß unerläßliche Studium der anorganischen Bestandtheile im Blute, wird, so glaube ich gewiß, zu den
intereßantesten Aufschlüßen über mehrere noch pathologische Prozeße führen! – Hochgeehrtester Herr Professor! Ihre größte Nachsicht muß ich in Anspruch nehmen, wenn ich mir diese Zeilen erlaubte;
ich bewege mich ja noch auf ganz hypothetischem Gebiete und wende mich an Sie mit meinen Gedanken, da ich durch das Studium Ihrer Werke die erste Anregung erhielt.
Es ist mir ein zu peinigendes Geschäft am Krankenbette rein empirisch, ohne rationelle Basis, in den Tag hinein zu verordnen, als daß ich nicht mit allen Kräften dahin streben sollte, eine
Aufklärung zu verschaffen.
Leider fehlt es mir hier an hinreichendem Material zur Beobachtung. - Sehen Sie, hochgeehrtester Herr Professor meine Zeilen als ein Zeichen größter Verehrung an; verzeihen Sie dem Anfänger die Unbescheidenheit, zu dem ihm sein Eifer vielleicht verleitet. - Durch wenige Worte, in denen ich Ihre Meinung hören könnte, würde ich unendlich glücklich sein.
Mit größter Hochachtung
ganz ergebenst
Dr. med. Beneke
Celle, den 12.ten August 1847
(Königreich Hannover)“
Justus von Liebig (1803 - 1873)
Unter dem in diesem Brief erwähnten phosphorsauren Kalk (Calcaria phosphorica) versteht man heute Calciumhydrogenphosphat (CaHPO4 · 2 H2O). Hier stellt sich das Problem der Löslichkeit und der Resorption durch den Darm bei der oralen Verabreichung. Phosphat bildet mit Calcium aber auch das unlösliche Calciumsalz (Ca3(PO4)2), das die Calcium-Resorption im Gastrointestinaltrakt vermindert. Bei F. W. Beneke kamen folgende Substanzen zur Anwendung (Beneke, 1850 a, Schmitter, 1986):
„Ich ließ nun den phosphorsauren Kalk so rein, als möglich darstellen; anfangs geschah dies durch Digeriren des Cornus cervi [Auslaugen von Hirschhorn] ust. ppt. [Durch Verbrennung,
lat.: propter: ppt.; ustulo: ust.] mit Phosphorsäure und nachheriges Trocknen des Präparates; später wurde er aus phosphorsaurem Natron und Chlorcalcium dargestellt, und dies letztere
Präparat namentlich in Anwendung gebracht“.
Die Dosierung gab F. W. Beneke in Gran an (Gran: altes Apothekergewicht; 1 Gran entspricht etwa 0.06 Gramm). Für einen Patienten verordnete er täglich zweimal 3 bis 4 Gran Calcaria phosphorica
über mehrere Wochen. Andere Ärzte verordneten Calcium in Form von Decoctum cornu cervi compositum, dessen Zusammensetzung F. W. Beneke folgendermaßen beschrieb (Beneke, 1870 c):
„... besteht in einer Abkochung von geraspeltem Hirschhorn (oder calcinierten Hirschhorn) mit Weissbrodkrumen und Gummi aribicum, der später Zucker und Orangenblüthenwasser zugesetzt
wird“.
Ein anderes Kalkpräparat der Mediziner war „weissgebrannte, ausgelaugte und pulverisirte Knochenerde“. Bei der Gabe von kalkhaltigen Substanzen und der nachfolgenden Beobachtung der Besserung von
Kalkmangelzuständen des Organismus dürfte es sich um die Resorption von Calciumionen handeln, wobei das Calciumphosphat selbst nicht als das eigentliche Heilmittel anzusehen ist. Calcium- und
Phosphationen sind zur Kalzifikation des Knochens notwendig. Wie man heute weiß kommt es beim Mangel eines dieser Elemente zu Mineralisationsstörungen des Knochens (Osteomalazie). Calciumionen
wirken im Organismus außerdem antiphlogistisch, antiallergisch, gefäßabdichtend und sind an der Blutgerinnung beteiligt.
Bei der Rachitis (englische Krankheit) handelt es sich um eine Erkrankung des Knochensystems bei Säuglingen und Kleinkindern. Es erfolgt eine zu geringe Kalkeinlagerung in die Knochen, wobei es
zu einer abnormen Weichheit der Knochen und Auftreibungen der Knochen-Knorpel-Grenze kommt. Heute weiß man, daß es durch Vitamin D-Mangel zu einer mangelhaften Kalzifizierung des Knochens kommt.
In sonnenarmen Klima, wie z. B. in England, kam es durch den Mangel an Ultraviolettstrahlen zu einem Vitamin D-Mangel, wodurch eine verminderte Calciumresorption aus dem Gastrointestinaltrakt
erfolgt. Durch die entstehende Hypokalzämie kommt es zu einer ständigen Gegenregulation der Nebenschilddrüse, was zu einem sekundären Hyperparathyreoidismus führt. Dadurch erfolgt eine starke
Kalkmobilisation aus dem Knochen sowie eine erhöhte Calciumrückresorption und verminderte Phosphatresorption in den protimalen Tubuli der Nieren mit entsprechenden Elektrolytverschiebungen im
Blutplasma und im Harn. F. W. Beneke hatte schon erkannt, daß der Kalkmangel an sich nicht die Ursache der Rachitis ist. Die von ihm behandelten Kinder kamen aus ärmlichen Gegenden in London und
litten häufig infolge schlechter Ernährungsverhältnisse an einem exogenen Kalkmangel, den F. W. Beneke durch höher dosierte orale Kalkzufuhr ausglich. F. W. Beneke legte großen Wert auf die
Verbesserung der Ernährung. Auch im Zusammenhang mit Skrophulose, Tuberkulose und Kalkmangel betonte er die Bedeutung der Diätetik, aber auch die Bewegung der Kranken im Freien in der Seeluft
(Beneke, 1850 a, b; Schmitter, 1986).
Schon aus vorgenanntem Brief geht hervor, daß F. W. Beneke gerne mehr Zeit für die Wissenschaft gehabt hätte, um mehr Forschung neben der Praxis betreiben zu können. In vielen Briefen an andere
Fachgenossen findet man immer wieder Hinweise, daß er gerne die akademische Laufbahn an einer Universität eingeschlagen hätte, um - losgelöst von einer lediglich praktischen Tätigkeit als
Hausarzt - in der medizinischen Forschung Fuß zu fassen. Dem stand aber die Tatsache entgegen, daß dies für einen jungen unbekannten Mediziner eine ungewisse Existenz bedeuten würde zumal die
Hochzeit am 14. Mai 1852 bevorstand (Schmitter, 1986).
Das Jahr 1848 führte F. W. Beneke als Hannoverscher Militärarzt nach Schleswig-Holstein. In einem Brief an Rudolph Wagner vom 26. Dezember 1848 schrieb er von seinen Plänen in England arbeiten
wollen und bittet diesen um ein Zeugnis. Man liest (Schmitter, 1986):
„Celle, 26. Dez. 1848
Hochgeehrtester Herr Hofrath
Im Vertrauen auf Ihre mir so oft erwiesene Güte und Liebe, für die ich Ihnen, so lange ich lebe, verpflichtet sein werde, wage ich es, Sie mit einer Bitte zu belästigen, deren Größe auch
Ihrer Nachsicht im doppelten Maaße in Anspruch zu nehmen heißt.
Aus der Militär Carriere die in jetziger Zeit nur dazu dienen kann, alle wißenschaftlichen Fortschritte zu untergraben, zurückgekehrt, stehe ich im Begriff, mich um die vacante Hausarztstelle
im German Hospital in London zu bewerben. Nach allem was ich davon gehört und weiß, entspricht diese Stelle ganz und gar meinem jetzigen Wunsche, der eigenen Beobachtung, der praktischen weiteren
Ausbildung bietet sich dort die schönste Gelegenheit. Da ich um Ihren Einfluß in England kenne, ich außerdem aber auch Zeugniße über Charakter, wißenschaftliche Ausbildung und praktische
Kenntniße beibringen muß, so möchte ich mir die unbescheidene Bitte erlauben, daß Sie mir ein solches Zeugniß in so weit Sie es geben können, zustellen.
Wenn auch das Maaß meiner Unbescheidenheit nur noch gehäuft wird, so bringt mich der sehr kurze Meldungstermin noch zu der zweiten Bitte, mir das Zeugniß baldmöglichst zu übersenden; wenn und
ob Sie es für geeignet halten, daß ich dasselbe an das Comité der Anstalt übersende - der Meldetermin ist schon am 6. Jan[uar 1849] abgelaufen.
Mit der nochmaligen Bitte um Entschuldigung meines Anliegens empfehle ich mich mit größter Hochachtung
Ihr ganz ergebener Dr. Beneke“
Schon am 29. Dezember 1848 bedankte sich Friedrich Wilhelm Beneke bei Rudolph Wagner für dessen Antwort vom 27. Dezember 1848, in dem dieser ihm Vorschläge für Empfehlungsschreiben an
verschiedene Persönlichkeiten in England macht. In einem Brief vom 17. Januar 1849 schrieb F. W. Beneke Rudolph Wagner folgende Zeilen (Schmitter, 1986):
„Celle, 17. Jan. 1849
Hochgeehrtester Herr Hofrath!
Mit dem aller herzlichsten Danke für Ihre so freundliche Empfehlung beeile ich mich, Ihnen mitzuteilen, daß ich mit dem 11. d[iesen] M[onats] zum Hausarzt des German Hospital gewählt
bin.
Somit heute, als am Tag meiner Doktor-Promotion ist die officielle Anzeige, dann bei mir eingetroffen u[nd] nun will ich hoffen, daß ich mit Nutzen meinem künftigen Amte vorstehen
kann.
Stets wird ich eingedenk sein, wem ich das wenige, was ich leiste zu danken habe, die Anregung zur Liebe wißenschaftlichen Treibens habe ich aus Göttingen mitgenommen, Ihnen hochverehrtester
Herr Hofrath, schulde ich sehr viel.
In 14 Tagen - 3 Wochen werde ich schon nach London abreisen. Wie mir gesagt ist, kommt dort Alles auf Empfehlungen an und ist es nicht zu unbescheiden, darum zu bitten, so haben Sie
vielleicht die große Güte, mich diesem oder jenem Physiologen oder Aerzte bekannt zu machen.
Nochmals meinen herzlichsten Dank mit der Bitte auch meiner im Ausland nicht ganz zu vergeßen.
Mit der größten Hochachtung
Ihr ganz ergebenster stets dankbarer
Dr. Beneke
Ich bitte Sie freundlichst um einen Gruß an Leuckart“.

Rudolf Karl Georg Friedrich Leuckart
Studienkollege von F. W. Beneke in Göttingen
Deutsches Hospital in London
Im Januar 1849 ging Friedrich Wilhelm Beneke an das Deutsche Hospital in London, wo er die Stelle des Hausarztes übernahm. Er lernte das englische Medizinalwesen kennen und kam in Bekanntschaft
mit den führenden englischen Ärzten und Chemikern. Das Bemühen der englischen Ärzte um die statistische Erfassung von Krankheits- und Todesfällen weckte sein besonderes Interesse. Dazu mußten die
Mediziner eng untereinander zusammenarbeiteten. Es wurde ihm aber auch noch besser bewußt als in den vorangegangenen Jahren, daß die Behandlung von Krankheiten einer wissenschaftlichen
begründeten Basis entbehre.
Einen ersten Bericht über die Arbeit in England und über die schlechte medizinische Ausbildung der englischen Ärzte erfährt man aus einem im März 1849 geschriebenen Brief von Friedrich Wilhelm
Beneke an Rudolph Wagner im März 1849 (Schmitter, 1986):
„Dalston, London, 13. März 1849
Hochgeehrtester Herr Hofrath!
Zu meiner großen Freude u. mit herzlichem Danke empfing ich vorgestern Ihre freundlichen Zeilen vom 11. d[ieses] M[onats]. Ich bin gestern gleich auf dem Weg zu Todd gegangen, habe ihn aber
nicht getroffen, kann Ihnen demnach auch von ihm selbst nichts berichten. Sollten Sie jedoch bis zu dem Empfang dieser Zeilen noch nichts von der Ankunft Ihres Aufsatzes erfahren haben, so freut
es mich, Sie benachrichtigen zu können, daß derselbe bereits im 34ten Bande der Cyclopaedie gedruckt erschienen ist. Gewiß würde ich meinen Besuch bei Dr. Todd alsbald wiederholen, wenn nicht die
Entfernungen so enorm groß wären u. mir meine Beschäftigungen Zeit dazu gäben; ich muß sehen, wenn ich die letztere finde, glaube aber keinesfalls Sie bis dahin ohne Antwort lassen zu dürfen.
Wegen Extracopien muß ich mir Mühe geben, doch fürchte ich, daß es schon zu spät ist; der 34 B[an]d der Cyclopaedie erschien schon am 15. Februar.
Weite Wege u. Mangel an Zeit machen mir leider auch den Besuch der hiesigen großen Anstalten fast unmöglich und ich bedaure von Herzen die Bekanntschaft hervorragender Leute u. Gebiete der
Wißenschaft so wenig cultivieren zu können. Das ist´s was hier ein Jeder beklagt, das aus dem reichen Schatze der hiesigen Materialien man gern den möglichst größten Gewinn zöge; ich brauch Sie
gewiß nicht erst zu versichern, wie sehr mein Streben nach möglichster Ausbildung und Erreichung des Erreichbaren gerichtet sein wird.
Ich habe in dieser Klage einen Trost, und den giebt mir meine eigene Thätigkeit. Ich kann in Wahrheit, sagen, daß ich mich außerordentlich glücklich fühle, und bin für jetzt in jeder Hinsicht
befriedigt. Sie werden mir erlauben, hochgeehrtester Herr Hofrath, Ihnen einige kurze Notizen über unsere Anstalt geben zu dürfen. Das deutsche Hospital liegt nahe vor der Stadt, in einer sehr
freundlichen frischen freien Umgebung. Es enthält augenblicklich 40 Betten, eine Zahl die lange nicht ausreicht, um die große Menge der Hilfesuchenden zu befriedigen; täglich muß ich 2-3
Patienten zurückweisen, u. es besteht keinen Zweifel, daß sobald die Fonds wachsen - wozu alle Aussicht vorhanden ist - eine bedeutende Vergrößerung vorgenommen werden wird. Neben den täglichen
40 Inpatients, haben wir täglich 20-30 Outpatients zu befriedigen, und ich brauche wohl nicht zu bemerken, daß die Abfertigung von 60-70 Patienten täglich sobald sie nicht oberflächlich sein
soll, das Höchste ist, was man erreichen kann. Die Outpatients werden eben so, wie die Patienten der dortigen Polyklinik behandelt. Drei Ärzte, Dr. Savaine, Dr. Sutro u. Dr. Straube geben mir in
ärztlicher Hinsicht die (superintenden), da jedoch jeder von ihnen nur zweimal wöchentlich herauskommt, so bleibt der größte Theil der Behandlung in meinen Händen und ein ganz kollegialisches
Verhältniß macht mir die Stellung zu diesen, auch noch jüngeren Herrn, sehr angenehm. Die wißenschaftliche Leistung derselben ist nicht sehr bedeutend, doch haben sie mich ausdrücklich gebeten,
eben in dieser Hinsicht, das offenste Verhältniß gegen sie einzunehmen u. auf diese Weise lernen wir gegenseitig.
Meine Versuche mit der Calcaria phosphorica, welche Ihnen vielleicht bekannt sind, setze ich schon mit vielem Erfolge fort; es ist höchst intereßant, die frappante Einwirkung desselben bei
scrophulösen Geschwüren zu beobachten. Auf meinen Wunsch wird unser Instrumental-Apparat sogleich durch ein Microscop und einen chemischen Apparat vervollständigt werden; die Bereitwilligkeit des
Comité allen Wünschen in dieser Hinsicht zu entsprechen ist nicht genug anzuerkennen. Ein Microscop denke ich von Oberhausen kommen zulassen; es sind mir £ 8-10 dazu bewilligt. Wüßten Sie mir,
hochgeehrtester Herr Hofrath eines besseren Rath im Betreff desselben zu geben, so würden Sie mich sehr verpflichten! Vielleicht ist in Göttingen ein gutes Microscop für jenen Preis zu haben.
–
Sie sehen also zu thun, zu lernen giebt es genug; ich wünsche nichts mehr, als daß es mir gelingt auch etwas zu leisten. In Betreff unseres Institutes will ich noch bemerken, daß es außer 5
Krankensälen, 5 Zimmer für einzelne Kranke, eine Apotheke, ein Consulting-Room für die Outpatients, 2 große Küchen, Badezimmer, Sanitäts- u. Commi(lten)zimmer, ein Zimmer für die Aerzte,
Wohnzimmer für die Matron u. Nurses und endlich meine beiden, sehr freundlich eingerichteten Zimmer enthält.-
Die Pflege der Kranken liegt liegt bei 4 Nurses und der beaufsichtigenden Matron, 5 Frauenzimmern welche dem Institut zu Nonnenwerth entnommen sind, die Matron hat die Geschäfte einer Hausfrau, und der Hausarzt hat für die Ordnung des ganzen Hauses mit seinem Personal zu sorgen.-
Reinlichkeit und Ordnung sind überall zu finden; die Pflege der Kranken ist unter jenen Händen sehr gut, kurz die Anstalt läßt in ihrer Einrichtung nichts zu wünschen übrig.-
Eins hat mich bis jetzt in London am meisten frappiert und das ist leider der traurige Zustand der hiesigen Medicin. Einige wenige ausgezeichnete und allgemein bekannte Männer abgerechnet,
sieht man sehr wenig von Bedeutung; und selbst etwas Bedeutendes kann versanden, ohne daß es zur Anerkennung kommt. - Die ganze Praxis ist hier in den Händen der general practitions, deren es
30.000 in England giebt. Diese Leute entbehren jedes wißenschaftlichen Fundaments und dennoch nehmen sie hier überall die Stellen der Hausärzte ein, da sie billiger sind u. zugleich Medizin
verabreichen. Ich sprach gestern mit einen solchen practitions und er erzählte mir, daß er jährlich circa 1300 £ verdiene, eine Aussage die durch seine brillanten Equipagen und seine ganze
Excistenz als mehr bewiesen wird. Die eigentlichen physicians und surgeons leben fast nur von Consiliar-Praxis. Vielen geht es leider sehr traurig, wohnend im Brodie, Key, Keate etc. täglich 30 -
40 £ einzunehmen haben. Was nun aber, und das ist die Hauptsache, bei diesen Zuständen in wißenschaftlicher Hinsicht geleistet wird, ist ihnen a priori anzusehen. Es ist traurig, daß in einem
Lande wie England, solcher Pfuscherei nicht von Grund auf Einhalt geschieht; es ist bejammernswerth, zu sehen, was diese practitioners oft mit den Patienten treiben, diese practitioners, welche
nicht im Stande sind eine Diagnose zu stellen und nichts kennen, als Rhabarb und blue pillo! -
Der Staat aber selbst trägt die Schuld. Während auf die Erziehung tüchtiger Juristen die größte Sorgfalt und Mühe verwandt wird, kümmert man sich um die Mediciner nicht; der klinische
Unterricht ist so oberflächlich, wie er nur sein kann; man kümmert sich wenig um Krankheitsprozeß, Diagnose und Therapie, und es ist erschrecklich zu sehen, wie die armen Patienten oft mit
Quecksilber vollgestopft werden. Man findet hier leider nur wenig Spuren deutscher Solidarität, deutschen Ernstes und deutscher Liebe für die Kunst. Der Quack hat in England immer noch die
Oberhand. - Gebe Gott: daß auch hier einmal ein neues Licht angezündet wird, viele Stimmen dafür werden schon laut und lauter! -
Herr Hofrath Wöhler hat mich um Blasensteine gebeten. Ich habe mich danach umgesehen, höre aber, daß man für solche aus Cystin hier immense Forderungen macht. Professor Hoffmann sagte mir, er
habe vergeblich 3 - 5 £ St[erling] für einen geboten. Unter diesen Umständen kann ich leider den Wünschen nicht entsprechen, wenn nicht H[er]r Hofrath Wöhler mir besondere Instuctionen ertheilt.
Vielleicht darf ich Sie bitten lieber Herr Hofrath, Ihrem Herrn Collegen dies mitzutheilen.
Die Intrigen gegen Dr. Freund, früherer Arzt am deutschen Hospital, von denen Herr Hofrath Faeto mir schrieb, returiren sich darauf, daß er sich durch Anmaßungen, Streitsucht, und schließlich
durch Schimpfworte gegen die Comités gab. Deshalb habe ich auch Böcker´s Arbeiten aufgenommen, und was man immer gegen dieselben sagen mag - und sie verrathen oft, daß der Autor kein tüchtig
physiologisch durchgebildeter Mann ist - sie haben dennoch Resultate ergeben, von denen sich eins nach dem anderen bestätigt; so die Coffeinwirkung, die Waßerwirkung, die Alkoholwirkung.
-
Sind wir erst etwas weiter, hat sich das Vertrauen hergestellt, so werden wir all diese Spezialia festlegen und aus der Zusammenstellung der Resultate vieler einzelnen Arbeiten unser
Reservoir ziehen ... Dann endlich kommt es darauf an, alle diese thatsächlichen Materialien zu verarbeiten, und ich bin überzeugt, daß sich der Arzt, so ausgerüstet, ganz anders am Krankenbette
fühlen wird, als jetzt, wo man oft ein Erröthen nicht unterdrücken kann ... Ich unterschätze sicher nicht dasjenige, was man „praktischen Takt“ nennt; meine sehr reiche praktische Thätigkeit in
England hat mich erkennen laßen, was ein einziger Blick auf den Kranken oft sagt, aber mit aller Erfahrung, obiter gesammelt, bin ich nicht befriedigt; ich sehne mich nach der Klarheit der ihn
die Stellung verdorben hat und genöthigt wurde zurückzutreten. Die Folge seines Benehmens ist leider ein Fallisment, die Oeffentlichkeit richtet hier Alles. -
Ihnen hochgeehrtester Herr Hofrath, danke ich einen großen Theil meines jetz(t)igen Glückes. Ich kann Ihnen gewiß diesen Dank nicht besser beweisen, als dadurch, daß ich den Grund, den Sie
mich gelegt haben, fort und fort auszubilden strebe; ewig dankbar und eingedenk Ihrer Güte wird dieses Streben mich hier leiten.
Mit größter Liebe und Hochachtung und mit der Bitte um freundliche Grüße an Ihren Herrn Collegen
Ihr ergebenster
Dr. Beneke
German Hospital, Dalston London d. 13.ten März 1849“
F. W. Beneke lernte in England neue urologische Methoden von Chemikern kennen, vertiefte seine englischen Sprachkenntnisse, was ihn in die Lage versetzte, Arbeiten englischer Ärzte zu lesen und
englische Publikationen zu verfassen (Beneke 1849, 1851a, b). Es entstanden erste Veröffentlichungen zu physiologischen und therapeutischen Fragen. Den Schwerpunkt bildeten Untersuchungen und
Arbeiten über phosphorsauren und oxalsauren Kalk, ein Thema, mit dem er sich immer wieder beschäftigte und durch die Untersuchungen von Justus von Liebig angeregt worden war.
Die ersten Beobachtungen skrophulöser Kranker in der Küstenstadt Margate bildeten den Ausgangspunkt für zahlreiche Untersuchungen, die F. W. Beneke später als Balneologe durchführte (Beneke, 1850
a, b). In einem programmatischen Buch „Unsere Aufgaben“ faßte F. W. Beneke alle Methoden und Desiderate klinischer Forschung zusammen in der organisatorisch neue Pläne, insbesondere der
Einführung einer für ganz Deutschland umfassenden Morbilitäts- und Mortalitätsstatistik, auf Grundlage des englischen Vorbildes einer öffentlichen Gesundheitspflege niedergelegt waren (Beneke,
1852 a). Benekes Ziel war es in Deutschland die Gründung eines „Vereins für gemeinschaftliche Arbeiten zur Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde“, unter der Mitarbeit aller Ärzte,
anzustreben. Im Herbst 1851 gab F. W. Beneke die Stellung in London auf, um sich als Privatdozent in Göttingen niederzulassen. Doch die Habilitation in Göttingen zerschlug sich, und er ging nach
Hannover (Martin, 1927, Beneke R, 1939; Schmitter, 1986).
In den (18)40er Jahren lebten in England über 30 000 Deutsche, die die größte Gruppe der Einwanderer ausmachte. Viele von ihnen lebten und arbeiteten unter ärmlichen Verhältnissen an der East End von London. Die Armut und dazu noch die Sprachenbarriere ließen ihnen kaum eine Chance eine angemessene medizinische Versorgung zu erhalten. Der preußische Gelehrte, Staatsmann und Gesandte in London (1841 bis 1854) Christian Karl Josias Freiherr von Bunsen (25.08.1791 Korbach (Waldeck) - 28.11.1860 Bonn) schlug vor ein Hospital für „arme deutsche Kranke“ in London einzurichten. Er ermunterte reiche Menschen in Deutschland und England Geld zu spenden, dazu konnte er noch die Königshäuser in beiden Ländern gewinnen, so daß schließlich das Hospital gebaut werden konnte. Das German Hospital in London eröffnete erstmals am 15. Oktober 1845 mit zwölf Betten und wurde zu einem Sprungbett für deutsche Mediziner und Schwestern das Ausland kennen zu lernen. Aber es wurden dort auch Engländerinnen zu Schwestern ausgebildet. So war Florence Nightingale (12.05.1820 Florenz - 13.08.1910 London) auch mehrere Monate am German Hospital um sich als Krankenschwester ausbilden zu lassen. Sie arbeitete 1854 als Krankenschwester mit weiteren 38 Schwesten in einem Lazarett auf der Krim als Briten, Franzosen und Türken den Russen den Krieg erklärt hatten. Jedoch wurden sie dort von den Ärzten weder beachtet noch gemocht. Dies änderte sich erst im Verlaufe der Kämpfe und Florence Nightingale ging in die Geschichte als die „Lady mit dem Licht“ ein. Um 1860 führte Florence Nightingale in England die „Nightingale Training School for nurses at St Thomas' Hospital“ ein.
Das German Hospital erhielt 1864 neue Gebäude und Räume, die nach dem damals höchstem Standard der Krankenhauswesens eingerichtet wurden. Sie bewährten sich bestens bei den Epidemien, in den 18(60)er und 18(70)er Jahren, die London heimsuchten.
German Hospital in den 19(40)er Jahren
Das deutsche Königshaus hatte größtes Interesse am German Hospital und suchte und fand immer wieder Spender für diese Einrichtung. Während des Ersten Weltkrieges kam es zu antideutschen
Kampagnen in England was zu einer Verminderung der deutschen Personals am German Hospital führte. Zwischen den beiden Weltkriegen normalisierte sich die Lage. Es kam zu weiteren Verbesserungen
der Gebäude und 1936 wurde ein neuer großer Flügel des German Hospitals eröffnet. Im Mai 1940, während des Zweiten Weltkriegs, wurde die Direktion des German Hospitals auf der Isle of Man
interniert. Es wurden englische Direktoren, Ärzte und Schwestern am German Hospital eingestellt, das nur noch seinen Namen behielt.
Im Jahre 1974 wurde das German Hospital Teil des City and Hackney Health District und wurde als Klinik für psychisch Kranke weitergeführt. Das German Hospital wurde 1987 endgültig geschlossen, als die Klinik in das neue Homerton Hospital verlegt wurde.
Hannover
Im Herbst 1851 kehrte F. W. Beneke schließlich nach Hannover zurück, wo er sich als praktischer Arzt niederließ. In den Sommermonaten 1852 und 1853 nahm er gleichzeitig die Stellung des Regierungs-Badearztes in Bad Rehburg ein, einem im 18. und 19. Jahrhundert bedeutenden Kurort. Der Kurort Bad Rehburg am Osthang der Rehburger Berge entstand nach der Einfassung der Mineralquelle 1690. Wirtschaftsgrundlage war der Kurbetrieb, 1821 zählte der Ort 188 Einwohner. Als Staatsbad für den Bereich Hannover fanden sich hier zu Erholungsmaßnahmen Adel und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ein. Der Staatsbadbetrieb Bad Rehburg endete im Jahre 1950. Für diesen Badebetrieb schrieb F. W. Beneke zwei Schriften, eine über Molkenkuren und eine über Kräuterkuren (Beneke,
1853 a, b)
Heute gehört Bad Rehburg zu der Stadt Rehburg-Loccum die im März 1974 aus den ehemals selbständigen Gemeinden Bad Rehburg, Loccum, Münchehagen, Rehburg und Winziar auf Grund des Neugliederungsgesetzes im Land Niedersachsen gebildet wurde.

Hannover (Markt um 1900)
Verein zur Förderung für gemeinschaftliche Arbeiten
zur Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde.
Im Herbst 1852 nahm F. W. Beneke an der 29. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Wiesbaden teil. Dort traf er auch seinen ehemaligen Studienkollegen aus Göttingen Carl (Friedrich)
Mettenheimer (1824 - 1898; seit 1895 in den Adelsstand erhoben), dessen Karriere als Badearzt und Leibarzt des Herzogs von Schwerin (1861) eine gewisse Ähnlichkeit mit der von F. W. Beneke hatte.
Diese Tagung bedeutete einen Wendepunkt für die Ärzteschaft, wie kaum ein anderer in der Geschichte der deutschen Medizin, indem hier die Gegensätze von alter und neuer Zeit, von Theorie und
Praxis aufeinanderprallten. Im Wesentlichen auf Betreiben von F. W. Beneke wird der Vorschlag erörtert, die deutsche Ärzteschaft zu einem „Verein zur Förderung für gemeinschaftliche Arbeiten zur
Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde“ zusammenzufassen. Dies war der erste Versuch eines Einzelnen, in Form einer Arbeitgenossenschaft staatserhaltende wissenschaftliche Aufgaben
herauszuheben und ihre Bearbeitung planmäßig zu leiten. Julius Vogel (1814 - 1880), ein Lehrer von F. W. Beneke, Professor für spezielle Pathologie und Therapie und Direktor der inneren Klinik in
Gießen, forderte die Versammlung am 20. September 1852 in einer längeren Ausführung zum Beitritt zu dem zu gründenden Verein auf. Dieser neue Gedanke wurde von der Versammlung nicht ohne weiteres
sofort aufgegriffen und in seiner grundlegenden Bedeutung erfaßt. Erst in verschiedenen Sitzungen und Vorbesprechungen wurde alles näher erörtert; es fanden sich unterstützende, aber auch
ablehnende Stimmen. Trotzdem bestand die Hoffnung, daß sich der Verein etablierte. Am 23. September 1852 legten Julius Vogel, Hermann Nasse (1807 - 1892), Professor und Leiter des physiologischen
Instituts in Marburg, sowie Friedrich Wilhelm Beneke einen Statutenentwurf sowie einen kurzes Programm vor, das die Aufgaben des zu gründeten Vereins umriß. Es kommt zur Gründung des „Vereins zur
Förderung für gemeinschaftliche Arbeiten zur Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde“. In dem vorgelegten Programm des Vereins hieß es u. a:
„Die ausserordentlichen Fortschritte, welche in den letzten Decennien die Physik, Chemie, Histologie, Physiologie etc. gemacht haben, konnten nicht verfehlen, auch auf die practische Medizin einen bedeutenden Einfluss auszuüben. Sie mussten bei Allen, denen der Fortschritt der wissenschaftlichen Heilkunde am Herzen liegt, den Wunsch hervorrufen, dieselben Methoden, welche in den eigentlichen Naturwissenschaften von so großen Erfolgen begleitet waren, auch auf die Medicin anzuwenden und die letztere allmälig zu einer exacten Wissenschaft zu machen“ (Fresenius, Braun 1853; Schmitter, 1986).
Dieser Verein, die erste Grundlage einer öffentlichen Gesundheitspflege in Deutschland, stand unter der Führung des Klinikers Julius Vogel und des Physiologen Hermann Nasse. Die mühevolle
geschäftliche und wissenschaftliche Leitung lag in den Händen von Friedrich Wilhelm Beneke.
Hermann Nasse (25.06.1807 Bielefeld - 01.07.1892 Marburg) studierte Medizin in Bonn (Promotion 1829), in Paris und in Berlin (Staatsexamen). Ab 1831 praktizierte er als Arzt und habilitierte sich
1832 für Chirugie und pathologische Anatomie an der Universität Bonn. Im Jahre 1837 wurde Nasse als außerordentlicher Professor der Medizin für Physiologie und theoretische Tierheilkunde an die
Universität Marburg berufen und war von 1838 bis 1879 Leiter des physiologischen Instituts in Marburg. 1848 wurde Nasse zum ordentlichen Professor für Physiologie in Marburg ernannt, wo er 1873
emeritiert wurde. 1867 bis 1892 war Nasse Vorsitzender der medizinischen Examinations- bzw. ärztlichen Prüfungskommission. Von 1890 bis 1892 war er auch Vorsitzender der zahnärztlichen
Prüfungskommission. Nasse wurde 1879 von der Universität Marburg der Dr. phil. h. c. verliehen.
Der Verein hatte ein eigenes Mitteilungsblatt „Correspondenzblatt des Vereins für gemeinschaftliche Arbeiten zur Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde“, deren Redaktion von 1853 bis 1863 Friedrich Wilhelm Beneke in 65 Nummern in alleiniger Verantwortung trug. Gleichzeitig gab der Verein ein „Archiv für gemeinschaftliche Arbeiten zur Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde“ heraus, das 1864 in „Archiv des Vereins für wissenschaftliche Heilkunde“ umgenannt wurde. Hier waren die Herausgeber von 1854 bis 1863 Band 1 bis 6, Friedrich Wilhelm Beneke, Julius Vogel und Hermann Nasse (Beneke 1853-1864; Beneke, Vogel, Nasse 1854-1863; Beneke, Vogel, 1864-1867; Vogel, Beneke (1864-1867).
Die 29. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Wiesbaden war nicht nur auf medizinischem Gebiet durch die Gründung des Vereins für gemeinschaftliche Arbeiten zur Förderung der
wissenschaftlichen Heilkunde von Bedeutung, sondern hatte auch auf politischem Gebiet einen Erfolg. Anläßlich der Feier ihres 200jährigen Bestehens der Kaiserlich Leopoldinischen Akademie der
Wissenschaften auf der Versammlung in Wiesbaden durchkreuzte Bismarck den Versuch der österreichischen Regierung, diese unter preußischem Schutz stehende Akademie nach Österreich zu
verbringen.
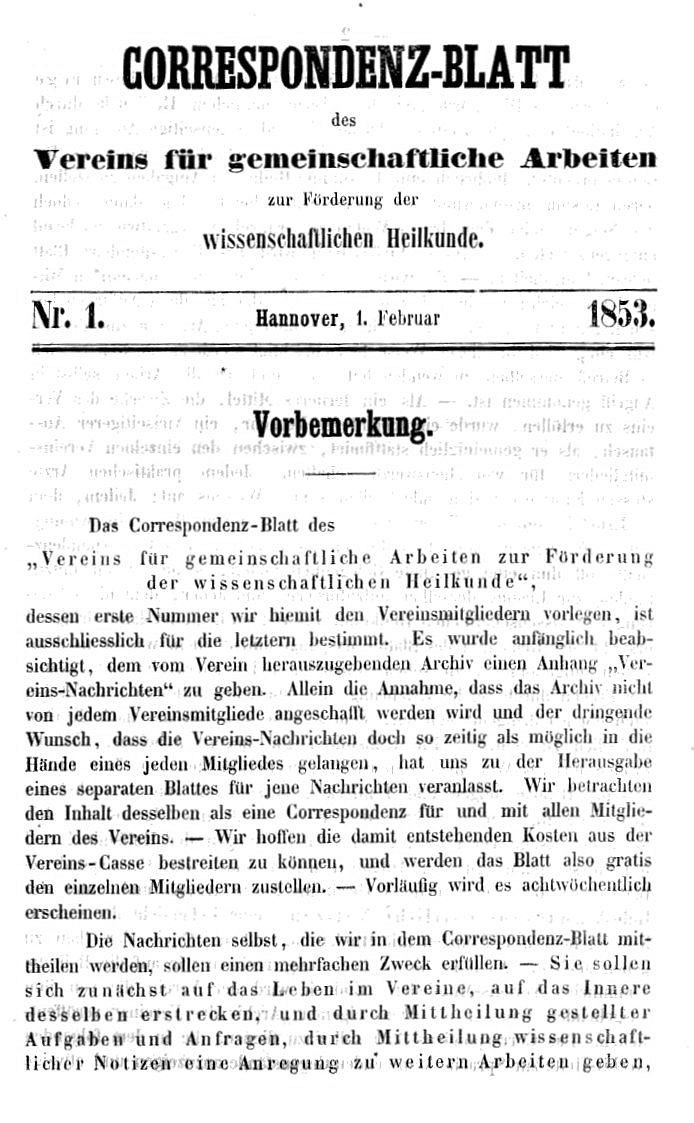
Im Correspondenz-Blatt des Vereins für gemeinschaftliche Arbeiten zur Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde stehen in der Nr. 1 vom 1. Februar 1853 einige interessante Angaben. Auf Seite 5
findet man unter Aufgaben:
„In Betreff der vorzunehmenden wissenschaftlichen Untersuchungen und Mittheilungen sprechen wir hier zunächst den Wunsch aus, dass sich die Vereins-Mitglieder überall gleicher Maasse und
Gewichte bedienen. Wir schlagen dazu die von Physikern und Chemikern längst für alle wissenschaftliche Untersuchungen gebrauchten neufranzösischen Maasse und Gewichte vor, und werden, da bei
mikroskopischen Untersuchungen bisher die Messungen meistens in Theilen der Pariser Linie gemacht wurden, zur Erleichterung der Reduction beider Maasse aufeinander, demnächst eine
Reductionstabelle dafür mittheilen.
Als Gewichtseinheit dient das Gramme. – 1000 Grammes = 1 Kilogramme = 2 Pfund Zollvereinsgewicht. – 1000 Milligrammes = 100 Centigrammes = 10 Decigrammes = 1 Gramme.
1 Pfund preussisches Medicinalgewicht = 350.78 Grammes
1 Pfund Nürnberger Medicinalgewicht = 357.56 Grammes
1 Pfund Medicinalgewicht in Baiern, Hannover, Hamburg, Dänemark, Würtemberg = 357.96 Grammes
Als Längs-, Volum- und Körpermaas dient der Meter. –
1000 Millemeter = 100 Centimeter = 10 Decimeter = 1 Meter.
1 Wiener Fuss = 0.3161 Meter
1 preussischer Fuss = 0.3138 Meter
1 bairischer Fuss = 0.2919 Meter
1 englischer Fuss = 0.3048 Meter
1 Pariser Fuss = 0.3248 Meter
1 badischer und sächsischer Fuss = 0,0300 Meter
1000 Cubikcentimeter (CC.) = 1 litre = 55.89 preussische Cubikzoll = 0.873
preussische Quart = 2 hessische Schoppen u.s.w.u.s.w.“
An diesen Beispielen sieht man die Schwierigkeit der Forschung, aber nicht nur der, in einer Zeit als jedes Land sich seiner eigenen Maße bediente. Bis zum 1. Februar belief sich die Anzahl im Verein für gemeinschaftliche Arbeiten zur Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde auf 94 Mitglieder. Gleichzeitig wurden Lokal- und Fachsektionen gebildet. Bis zum 1. Februar 1853 hatten sich Lokalsektionen gebildet in:
„1. Celle: Localvorstand: Sanitätsrath Dr. Scuhr
2. Dresden: Localvorstand: Dr. Seiler
3. Darmstadt: Localvorstand: Dr.
Simon
4. Elbdistrict (umw. Freiburg) Localvorstand: Dr. Alb. Schoenian
5. Frankfurt a. M.: Localvorstand: Dr. Mettenheimer
6. Giessen: Localvorstand:
Professor J. Vogel
7. Göttingen: Localvorstand: Dr.
Schuchhardt, Privatdoc.
8. Hannover: Localvorstand: Dr.
Beneke
9. London: Localvorstand: Dr. Weber (German Hosp.)
10. Lüneburg: Localvorstand: Med.-Rath Dr.
Hillefeldt
11. Marburg: Localvorstand: Professor H. Nasse
12. Wiesbaden: Localvorstand: Dr. Gergens“.
Die drei Vorstände des Vereins für gemeinschaftliche Arbeiten zur Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde waren auch gleichzeitig Lokalvorstände in verschiedenen Städten. F. W. Benekes
Studienfreund Carl Mettenheimer wurde Lokalvorstand in Frankfurt am Main.
In der Nummer 1 vom 1. Februar 1853 des Correspondenzblatt des Vereins für gemeinsame Arbeiten zur Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde findet man auf den Seiten 11 und 12 etwas über die
Fachsektionen des Vereins:
„In Betreff der Fachsectionen:
Sie sollen zur Erleichterung des wissenschaftlichen Verkehrs dienen. Auch sie werden ihre Vorstände haben, und diese werden jederzeit bereit sein, über die in das betreffende Fach
einschlagenden Fragen und Arbeiten, so wie über die Theilnehmer der Arbeit Auskunft zu geben. - Wir ersuchen diejenigen Mitglieder, die sich einer bestimmten Fachsection anzuschliessen wünschen
sollten, uns baldmöglichst davon in Kenntnis zu setzen. Die Fachsectionen selbst werden die folgenden sein:
1) Section für Physik in ihrer Anwendung auf Medicin
2) Section für Anatomie, vergleichende Anatomie und Physiologie
3) Section für Chemie überhaupt und Zoochemie im Besonderen
4) Section für Physiologie und Pathologie des Blutes
5) Section für Untersuchung der Excreta (Urin, Faeces, Lungenexhalation, Hautausdünstung, Milch
6) Section für Physiologie und Pathologie des Nervensystems
7) Section für pathologische Anatomie
8) Section für Aetiologie der Krankheiten (Krankheitsursachen überhaupt, meteorologische Verhältnisse u. s. w.)
9) Section der Diagnostik
10) Section für medicinische Geographie
11) Section für innere Krankheiten (mit verschiedenen Unterabtheilungen: Brust-, Herz-, Unterleibskrankheiten; - Typhus, Gicht u. s. w.)
12) Section für chirugsche Krankheiten
13) Section für Augen- und Ohrenkrankheiten
14) Sektion für Geburtshilfe
15) Section für Psychatrie
16) Section allgemeine Therapie und Heimittellehre (Arzneiprüfungen, Balneologie, Hydrotherapie u. s. w. )
17) Section für gerichtliche Medizin“.
Diese vielseitige Liste der Sektionen überrascht doch etwas. Bedenkt man, zu welcher Zeit diese Liste aufgeführt wurde, zeigt sie ein Gespür für die moderne Medizin. Sie zeigt ganz klar die
Handschrift von Friedrich Wilhelm Beneke. Es war sein Anliegen, als Mediziner und Forscher naturwissenschaftlich orientiert zu arbeiten. In der Arbeit für und sein Einsatz im „Verein für
gemeinschaftliche Arbeiten zur Förderung der wissenschaftliche Heilkunde“ sah er die Möglichkeit, die Heilkunde als eine den (übrigen) Naturwissenschaften ebenbürtige Wissenschaft zu betreiben
und zu verbreiten.
Auf den Seiten 13 und 14 der vorgenannten Ausgabe des Correspondenzblatt des Vereins für gemeinsame Arbeiten zur Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde findet man die Vereinsstatuten.
„Statuten des Vereins für gemeinschaftliche Arbeiten zur
Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde
§ 1. Es ist eine Anzahl von Aerzten zu dem Zwecke zusammengetreten, Aufgaben der wissenschaftlichen Heilkunde gemeinschaftlich zu bearbeiten.
§ 2. Der Verein führt den Namen: „Verein für gemeinschaftliche Arbeiten zur Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde.“
§ 3. Die Aufgaben sollen durchaus eine directe Beziehung zur praktischen Heilkunde haben; sie sollen sich aber auf kein bestimmtes Gebiet derselben beschränken.
§ 4. Die einzelnen Mitglieder des Vereins wählen sich selbst ihre Aufgaben; es soll jedoch alljährlich eine Reihe von Fragen aufgestellt werden, deren Beantwortung als besonders
wünschenswerth erscheint.
§ 5. Bei der Lösung der Aufgaben soll, so weit es möglich ist, eine bestimmte Methodik der Untersuchung eingehalten werden; es sollen vor Allem gleiche Maasse, Gewichte u. s. w. benutzt
werden. Für die Bearbeitung einzelner Krankheitsbeobachtungen und Sectionsbefunde wird die Zugrundlegung gemeinschaftlich festgestellter Schemata als wünschenswerth erachtet.
§ 6. Mitglied des Vereins ist Jeder, der thätigen Antheil an den Arbeiten nimmt oder den Verein durch einen Geldbetrag von mindestens einem Thaler unterstützt.
§ 7. Die Geschäftsführung des Vereins wird von einem aus 3 Vereins-Mitgliedern bestehenden Vorstande besorgt. Eins dieser Mitglieder führt die Secretariatsgeschäfte.
§ 8. Findet sich eine grössere Anzahl von arbeitenden Mitgliedern, so sollen zur Erleichterung des wissenschaftlichen Verkehrs Fachsectionen, zur Erleichterung des geschäftlichen Verkehrs
Localsectionen gebildet werden. Jede derselben wählt sich aus ihrer Mitte einen Vorstand.
§ 9. Für die Publication der vom Vereine ausgehenden Arbeiten wird ein Archiv eröffnet, welches in zwanglosen Heften erscheint.
§ 10. Die Redaction des Archivs liegt dem Secretair des Vereins ob.
§ 11. Neben dem Archiv erscheint 8-wöchentlich ein Correspondenz-Blatt, welches die zur Zeit in Angriff genommenen Arbeiten, den Bestand des Vereins, Personalveränderungen u. s. w. zur
Kenntniss der einzelnen Mitglieder bringt.
§12. Neben dem schriftlichen Verkehr hält der Verein womöglich alljährlich ein- oder zweimalige Zusammenkünfte, zu deren einer der Ort der „Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte“
bestimmt wird.
§ 13. Zur Deckung der Correspondenzkosten, geschäftlicher Auslagen, der Druckkosten für zu vertheilende Schemata, Unterstützung wissenschaftlicher Untersuchungen u. s. w. erlegt ein jedes
Mitglied jährlich einen Thaler. Die Eincassierung dieser Beiträge wird von dem Secretair des Vereins, resp. dem Vorstande einer jeden Localsection, besorgt, und alljährlich Rechnung darüber
abgelegt.
§ 14. Die Beitritts-Erklärung zum Verein, so wie eine etwaige Austritts-Erklärung geschieht schriftlich bei einem Mitgliede des Vorstandes, dem Secretair oder einem
Localvorstande“.
In den einzelnen Nummern des Correspondenz-Blatt des Vereins für gemeinschaftliche Arbeiten zur Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde findet man folgende interessante Mitgliederzahlen:
Nummer des Korrespondenzblattes (Seite)
|
Nr.1 (9) |
|
Nr. 2 (21-23) |
|
Nr. 3 (32-34) |
|
Nr. 4 (46-47) |
|
Nr. 5 (62) |
|
Nr. 6 (80) |
|
Nr. 7 (93) |
|
Nr. 9 (114) |
|
Nr. 10 (126) |
|
Nr. 11 (135) |
|
Nr. 12 (149) |
|
Nr. 13 (159) |
|
Nr. 14 (170) |
|
Nr. 15 (187) |
|
Nr. 16 (201) |
|
Nr. 17 (218) |
Datum
1. Februar 1853
|
1. April 1853 |
|
1. Juni 1853 |
|
1. August 1853 |
|
20. November 1853 |
|
25. Januar 1854 |
|
1. April 1854 |
|
25. August 1854 |
|
15. Oktober 1854 |
|
8. Dezember 1854 |
|
15. Februar 1855 |
|
15. April 1855 |
|
15. Juni 1855 |
|
25. August 1855 |
|
1. November 1855 |
|
1. Januar 1856 |
Mitgliederzahl
|
94 |
|
127 |
|
212 |
|
241 |
|
267 |
|
286 |
|
293 |
|
300 |
|
309 |
|
312 |
|
314 |
|
319 |
|
321 |
|
323 |
|
326 |
|
334 |
Anhand der Mitgliederzahlen kann man sagen, daß der „Verein für gemeinschaftliche Arbeiten zur Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde“ ein schnell akzeptierter wissenschaftlicher Verein
wurde. Seine bekanntesten Mitglieder waren außer den schon vorher genannten drei Vorsitzenden der Zoologe Rudolf Karl Georg Friedrich Leuckart (1822 - 1898) aus Gießen, der Chirurg Johann
Friedrich August von Esmarch (09.01.1823 Tönning - 23.02.1908 Kiel) aus Kiel, der Chemiker August Friedrich Carl Himly (1811 - 1885) aus Kiel, dessen Bruder der Göttinger Mediziner, Anatom und
Physiologe Ernst August Wilhelm Himly ein Lehrer von F. W. Beneke war. Das wohl bekannteste Mitglied des Vereins war der Pathologe, Anthropologe und Sozialpolitiker Rudolf Virchow (13.10.1821
Schivelbein (Pommern - 05.09.1902 Berlin), damals noch in Würzburg. Bei den Lokalsektionen des Vereins hatte Kiel die meisten Mitglieder.
Der „Verein für gemeinschaftliche Arbeiten zur Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde“ stellte in seinem Korrespondenzblatt immer wieder Aufgaben, berichtete über eingegangene Beobachtungen, gab wissenschaftliche Notizen heraus und berichtete über die Lokal- und Fachsektionen. Auch gab es Preisfragen, welche prämiert wurden. Im Jahre 1855 hieß die Preisfrage: „Welchen Einfluß hat der innerliche Gebrauch verschiedener Quantitäten von gewöhnlichem Trinkwasser unter verschiedenen Verhältnissen auf den Stoffwechsel“. Dazu wurden drei Arbeiten eingereicht. Die am besten beurteilte Arbeit wurde von Dr. Fr. Mosler, Assistent an der Medizinischen Klinik in Gießen eingereicht, und mit 100 Thaler prämiert wurde.
Durch seine Kenntnisse der in- und ausländischen Methoden in der Medizin und durch seinen geprägten praktischen Verstand gestaltete F. W. Beneke die für Deutschland erforderlichen Maßnahmen immer
vollkommener. In einer Sonderschrift faßte er die bis dahin in den deutschen Ländern vorhandenen Anfänge einer wissenschaftlich brauchbaren Morbilitäts- und Mortalitätsstatistik für Deutschland
als ein Mittel zur wissenschaftlichen Begründung der Ätiologie der Krankheiten zusammen (Beneke, 1857). Dafür warb und wirkte er auf den Naturforscherversammlungen in Wien (1856) und Bonn (1857)
nachdrücklich und erfolgreich. Die Hoffnung von F. W. Beneke auf eine freiwillige Beteiligung der Ärzteschaft an der bis ins letzte Detail ausgearbeiteten Statistik, war sehr schwierig. Erst 1875
wurde das Werk von F. W. Beneke „Vorlagen zur Organisation der Motalitätsstatistik in Deutschland“ mit seiner umfassenden Darstellung aller bis dahin im In- und Ausland geschaffenen Bestimmungen
für die Reichsgesetzgebung maßgebend (Beneke, 1875).
Der „Verein für gemeinschaftliche Arbeiten zur Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde“ wurde 1869 aufgelöst und der neugegründete „Verein für öffentliche Gesundheitspflege“ übernahm dessen
Aufgaben. In zwei Werken entwickelte F. W. Beneke historisch festgelegte und vorausschauende Leitmotive für das Reichsgesundheitsamt (Beneke, 1870 a, 1872; Beneke R., 1939).
In einem Brief an Karl Victor Klingemann, Legationsrat der Gesandschaft Hannover, den F. W. Beneke bei seinem Aufenthalt in England kennengelernt hatte, berichtet er etwas über sein Privatleben und die traurigen Erlebnisse seiner Schwester (Schmitter, 1986):
„Hannover, 4. Jan. 1852
Mein liebster Klingemann!
Daß ich den innigsten Anteil an dem harten Schlage, der Sie betroffen hat, genommen habe, bedarf gewiß keiner Versicherung; daß ich Ihnen nicht eher meiner Theilnahme versicherte, hat in dem
Glauben seinen Grund, daß, wohlthuend einerseits das Mitgefühl der Freunde ist, die Zeichen dieses Mitgefühls frische Wunden nur von Neuem schmerzen laßen. Auch heute wagte ich es kaum schon,
Ihnen zu schreiben, wenn ich nicht jetzt ein gleiches Leid in meiner Familie beklagte. Meine Schwester, die Direktorin Hoffmann [Auguste Charlotte Heloise Hoffmann geb. Beneke 18.07.1832 -
24.02.1852] in Lüneburg, verlor vor 8 Tagen ihr einziges Kind an der gleichen Krankheit, wie Sie das Ihrige. - Ich empfinde jetzt zu lebhaft die Härte solcher Geschick, als daß ich nicht zu Ihnen
sprechen müßte! Doch was soll ich sagen? - Sie und Ihre liebe Frau haben die Festigkeit und den Grund in sich, der allein jene Schmerzen erträglich macht. - Sende Ihnen Gott bald Ruhe und neue
Freude! –
Wunderbar mischen sich Schmerz u[nd] Freud. - Meine Schwester verlor Ihr Kind, während meine Eltern bei Ihr das Fest zu feiern gedachten und statt des Festes, die ganze Trauer mit ihr
durchlebten, während ich in Bremen glückliche Stunden bei meiner Braut verlebte! - Seit wenigen Wochen bin ich in eine neue Phase meines Lebens getreten und mit Fräulein Süsette Sengstack in
Bremen verlobt! –
Wie traurig uns der Schluß des Jahres durch die Nachrichten aus Lüneburg wurde, bedarf keiner Versicherung!
Nehmen wir, was Gott uns sendet! Im Vertrauen auf seine Liebe laßen Sie uns allesamt das neue Jahr beginnen! –
Ihnen, meinem so lieben Freund, kann ich nicht verschweigen, was mehr oder weniger noch Geheimniß ist. Deshalb theile ich Ihnen auch meine Verlobung, die mir selbst unerwartet gekommen ist,
mit. - Es ist nicht unmöglich, daß meine ganze Zukunft damit eine neue Wendung erhält und ich ganz nach Bremen ziehe. - Die Aussichten auf praktische Thätigkeit sind dort bei Weitem beßer, als
hier, - wo Jahre vergehen, ehe man zu thun hat. Brande, by the bye, hat mit (...) seine ganze Praxis oder vielmehr seine Medicin aufgegeben und will „dem lieben Gott nicht länger ein Tagedieb
sein.“
Das Betreten der academischen Carrière, welche ich bei meinem Fortgang v[on] England u[nd] bei meiner vorläufigen Niederlaßung im H[annover] im Auge hatte, ist mir durch die Verhältniße in
Goettingen und durch mein jetzigen Hinweis auf baldige gesicherte Existenz augenblicklich leider in weite Aussicht gerückt. - Vielleicht, daß ich später das Glück habe, durch literarische
Arbeiten u.s.m. den Weg zu bahnen. –
Ade. Beneke hat ihnen und Ihrer lieben Frau hoffentlich meine Grüße u[nd] meine innigste Theilnahme bezeugt. - Schreiben Sie mir doch selbst bald einmal, lieber Klingemann, wie es Ihnen geht.
Ich selbst lebe jetzt noch in einer derartigen Unruhe, daß ich keinen längeren Brief und am wenigsten einen guten, wie er für Sie sein muß, zu Stande bringen kann. - Möchten Ihnen diese Zeilen
nur einen Beweis meiner innigen Anhänglichkeit geben! Nie werde ich England u[nd] meine dortigen Freunde vergeßen können!
Von ganzem Herzen
Ihr
Beneke
Karl Victor Klingemann (02.12.1798 Limmer an der Leine im Königreich Hannover - 25.09.1862 London) wurde erst Schreiber bei der hannoverschen Regierung und kam mit 18 Jahren nach Paris und wurde Mitglied einer Liquidations-Kommission. Danach wirkte er als Kanzlist der Königlichen Gesandtschaft in Berlin, wo er eine eingehende wissenschaftliche und gesellschaftliche Weiterbildung erfuhr. Klingemann hörte juristische und staatswissenschaftliche Vorlesungen an der Universität Berlin, dichtete und komponierte. Er wurde ein enger Freund des Musikers und Komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdy (03.02.1809 Hamburg - 04.11.1847 Leipzig), was in einem langjährigen Briefwechsel dokumentiert wird.

Felix Mendelssohn-Bartholdy
(1809 - 1847)
1822 wurde Klingemann zum „extraordinären“ Kanzlisten ernannt und erhielt 1827 eine Anstellung in London bei der Königlich-Deutschen Kanzlei als außerordentlicher Abgesandter und bevollmächtigter Minister, Sekretär und Geheimer Registrator, „mit den Geschäften eines Legations-Kanzlisten beauftragt“. Als 1837 die Auflösung der Personalunion zwischen England und Hannover erfolgte, trat an ihre Stelle eine Gesandtschaft, in der Karl Klingemann, später als Legationsrat, wirkte. In dieser Funktion lernte ihn F. W. Beneke in London kennen. In seinem Londoner Haus trafen sich zahlreiche bedeutende, vor allen Dingen auch deutsche Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Musik und Dichtung (Schmitter, 1986).
Der Sohn von Karl Victor Klingemann Karl Klingemann (29.11.1859 Hannover - 01.02.1946 Bonn) war u. a. Professor der Theologie an der Universität Bonn.
In einem Brief vom 15. Februar 1852 schrieb Friedrich Wilhelm Beneke an Justus von Liebig (Schmitter, 1986):
„Hochgeehrtester Herr Professor!
Ich nehme mir die Freiheit, Ihnen anliegend ein Exemplar meiner eben erschienenen kleinen Arbeit zu übersenden. Es ist mir die Publication derselben aus Furcht vor dem Tadel der Anmaßung
schwer geworden; nur in der Hoffnung, daß die gestellten Aufgaben als richtig anerkannt werden - und damit ein Antrieb zum praktischen Angriff pathologisch-(...) Fragen geben wird, habe ich jene
Furcht überwinden können. - Ja der überaus intereßanten Entwicklungsperiode einer neuen Pathologie und Therapie, in welcher wir leben, kann meiner unmaßgeblichen Ansicht nach nicht mehr von
abgeschlossenen Zusammenstellungen, von Systemen, die Rede sein; es ist Sache des eisernen Fleißes das riesenhafte Material von Neuem durchzuarbeiten, jeden Fall mit Hülfe der Microskopie und
chemischer Waage zu analysieren; und dann vielleicht in Jahren einen neuen Versuch eines streng naturwißenschaftlichen Systems zu versuchen. Zu solchem Fleiße aber möchte ich alle die jungen
Kräfte zu vereinigen suchen, denn wie wenig der Einzelne zu leisten vermag, das habe ich nur zu wohl im Hospitale in London erfahren ...
Ich bedaure nichts mehr, als einzelne Werke erst nach Absendung des Manuscripts in die Hände bekommen zu haben, welche für den fraglichen Gegenstand das größte Gewicht hatten. Ich rechne dazu vor Allem die 3. Ausgabe Ihrer „chemischen Briefe“, die mir in den letzten Wochen ein unendliches Intereße gewährt haben. Dankte ich dem Studium Ihrer früheren Werke die erste Anregung zu meinen unbedeutenden Arbeiten, so danke ich dieser eine neue und, wenn möglich, noch größere; denn sie befestigt in mir die Ueberzeugung, daß der von mir eingeschlagene Weg, um zu einer rationellen Therapie zu gelangen, der richtige ist; es handelt sich nicht um Ansichten, sondern um unumstößliche Naturgesetze. Unbegreiflich es, daß, wie ich es jetzt erfahre, die Begriffe vom Stoffwechsel, insonderheit von der Bedeutung der unorganischen Blut- und Fleischbestandtheile sich noch so wenig Eingang in die praktische Medicin verschafft haben; unbegreiflich, daß diesen so unendlich intereßanten Studien noch immer kein reger Fleiß und kein lebendiges Intereße zugewandt wird! Die Menge von Anhaltspunkten, Ihrem Briefe einer rationellen Diätetik an die Hand geben, ist mir unschätzbar, die mitgetheilten Thatsachen, die Abhängigkeitsverhältniße zwischen organischen und anorganischen Blutbestandteilen, wie Sie sie dargestellt haben, finden in meinen Beobachtungen am Krankenbette eine so schlagende Bestätigung, daß ich nur um so mehr allen Fleiß auf den Verfolg dieser Arbeiten verwenden möchte. - Ich habe England verlaßen, lediglich aus dem Grunde, um dort nicht durch die Praxis allen wißenschaftlichen Arbeiten entzogen zu werden. Die Stellung am Hospital war nur zu erfreulich, allein es war bei ihr nie an die Begründung einer selbständigen Existenz zu denken´ und, wiewohl meine Privat-Praxis im Aufblühen war, so schwer es mir wurde, das herrliche Volk und Land zu laßen, ich that es, um hier mehr arbeiten zu können. Leider sind bis dahin meine Bemühungen, mir eine Thätigkeit geben und zugleich meine Excistenz sichernde Stellung zu verschaffen vergeblich gewesen, - ich wage es nicht, die unsichere Carrière des Privat-Docenten zu betreten, wiewohl meine Neigung entschieden zur academischen Carrière hin (...). Vorläufig habe ich mich in Hannover (habilitiert), da ich, wiewohl die Aussichten auf Praxis sehr schlecht sind, hier doch Hospitäler, Bibliotheken und Museen finde, die mir in meiner Vaterstadt Celle nur sehr fehlten; - im Stillen aber hoffe ich darauf, daß sich mir bald hier oder dort ein anderes Feld der Thätigkeit eröffnet. –
Doch ich muß um Entschuldigung bitten, daß ich Sie mit solchen Nachrichten belästige. -
Es handelt sich in meinem Schriftchen und in Betreff der gestellten Aufgaben zunächst darum, einen Plan zu einer gemeinsamen Arbeit zu entwerfen ... Wollten Sie, hochgeehrtester Herr
Professor, mich mit Ihrer Ansicht darüber oder mit Rathschlägen erfreuen, so würde ich es Ihnen nicht genug danken können. - Ein dritter kleiner Beitrag zur physiol[ogischen] Heilkunde „über
Oxalurie“ befindet sich augenblicklich im Druck; nach der Beendigung desselben bitte ich Sie um Erlaubniß Ihnen denselben mittheilen zu dürfen. –
Genehmigen Sie zum Schluß den Ausdruck meiner größten Verehrung mit welcher ich verbleibe
Ihr unterthänigster und dankbarster
Dr. Beneke
Hannover d. 15t Februar 1852“

Justus von Liebig
(1803 - 1873)
Auch in diesem Brief an Justus von Liebig kommt wieder der Wunsch einer Hochschulkarriere von Friedrich Wilhelm Beneke durch. Aber gleichzeitig machte er auch auf die ungesicherte Zukunft eines
Privatdozenten aufmerksam. Dies lag sicher mit daran, da er sich im Mai 1852 verheiraten wollte. Auf jedem Fall hat er schon damals sehr neben seiner Praxis wissenschaftlich gearbeitet.
Friedrich Wilhelm Beneke heiratete am 14. Mai 1852 Eugenie Julie Süsette Sengstack (02.07.1825 Bremen - 09.02.1907 Marburg). Deren Eltern waren Georg Friedrich Sengstack (1779 - 1855) aus Bremen
und Christel Grund aus Dresden (1783 - 1867), die insgesamt 16 Kinder hatten. Aus der Ehe von Friedrich Wilhelm Beneke und Süsette Beneke gingen sechs Kinder hervor:
Der spätere Gymnasialdirektor in Hamm, Georg Friedrich (genannt Freddy) Beneke, geboren 3. März 1853 in Hannover, verstorben am 24. Juni 1906 in Marburg. Verheiratet mit Cäcilie
Gräfin von Rotsman (28.01.1854 Alsfeld - 17.01.1898 Hamm). Kind: Franz Friedrich Ludwig Wilhelm Beneke (geb. 05.09.1879 Marburg - ?).
Adelheid Christine Caroline (genannt Lily) Beneke, geboren am 2. Juni 1854 in Oldenburg, verstorben am 3.März 1919 in Marburg. Verheiratet mit dem Professor der Geschichte in Marburg und Straßburg Ed. Conrad Varrentrapp (17.08.1844 Braunschweig - 28.04.1911 Marburg). Kinder: Dorothee Süsette Elisabeth Varrentrapp geboren 02.10.1879 in Marburg und Franz Wilhelm Adolf Hermann Varrentrapp geboren 20.11.1884.
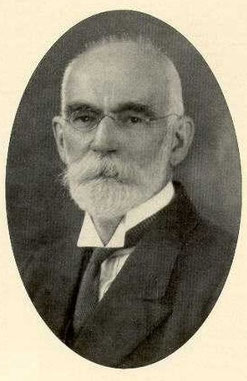
Rudolf Beneke (1861 - 1945)
Carl Heinrich Hermann Beneke, geboren 14. Juli 1855 in Oldenburg, späterer Oberstleutnant.
Adolf Julius Eduard (genannt Edu) Beneke, geboren am 25. Oktober 1857 in Marburg, verstorben am 28. März 1917 ebenfalls in Marburg. Verheiratet mit Therese
Süsette Sengstack (geb. 18.10.1865 Bremen). Kind: Julie Marie Erika Jeanette Beneke (geb. 06.06.1898 Marburg).
Der spätere Professor für Pathologie in Marburg und Halle Carl August Caesar Rudolf (genannt Rudi) Beneke, geboren am 22. Mai 1861 in Marburg, verstorben am 1. April 1945 in Marburg. Verheiratet in erster Ehe mit Helene Eichorius (28.08.1862 Leipzig). In zweiter Ehe mit Maria. Kind: Wilhelm Beneke (adoptiert) (geb.16.05.1905).
Theodor Beneke, geboren am 23. April 1864 in Marburg, verstorben am 2. Dezember 1864 in Marburg.
In einem Brief aus Hannover an Rudolph Wagner in Göttingen vom 19. April 1853 erfährt man u. a. auch etwas mehr über das Privatleben von Friedrich Wilhelm Beneke (Schmitter, 1986):
„Hochgeehrtester Herr Hofrath!
Rechnen Sie mir´s nicht zu hoch an, daß ich Sie nicht besonders von den freudigen Veränderungen meiner Lebensverhältnisse in Kenntniß setzte. Meine Verlobung sollte im Herbst 1851 nicht bekannt werden, ich ließ deshalb keine Karten drucken und daß man mir eine Stelle geben wollte die mich schnell zum heirathen befähigte erfuhr ich erst 3 Wochen vor Beginn der Saison in Rehburg. In diesen 3 Wochen mußte Aufgebot, Hochzeit, Umzug nach Rehburg u.s.m. durchgemacht werden und so habe ich mir leider das Vergnügen versagen müßen meinen Freunden darob die freudige Anzeige meiner damaligen Lebenswendung zu machen. Nur 3 Zeitungen wurden benachrichtigt, und was ich mir damit an Unart habe zu Schulden kommen laßen, muß ich wieder gut zu machen suchen. Ich danke Ihnen nun aber um so herzlicher für Ihren Glückwunsch, den ich kaum noch verdiene.
Bad Rehburg (um 1870)
Heute habe ich den ersten Ausflug mit dem Söhnchen [Georg Friedrich (genannt Freddy) geboren 3. März 1853] und ich danke Gott von Herzen für diese Freude, da es uns Allen ja Gottlob! wohl
geht. –
Für den weiteren Inhalt Ihres Briefes danke ich ebenfalls herzlichst. Ich werde die nächste Gelegenheit benutzen, den Gegenstand zur Sprache zu bringen, und ich hoffe, daß Sie schon
mittlerweile einige Nachrichten aus Braunschweig oder Leipzig oder Marburg erhalten, wohin ich Ihre Frage bereits mittheilte.
Ich bin überzeugt, daß Ihnen eine Ausspannung in Rehburg und dortigen Molkengebrauch sehr wohl thun würde. Wie sehr es mich freuen sollte, Sie dort zu sehen, bedarf wohl keine Versicherung.
Ich erlaube mir, ihnen mein flüchtig geschriebenes Schriftchen über Rehburg zu übersenden. Die Molkenanstalt wird am 13. Juni eröffnet. - Kann ich Ihnen irgendwie dort dienen, durch
Logisbestellung u.s.m. so geschieht es mit größter Freude.
Also nochmals seien Sie ob meines Stillschweigens nicht böse; ich mußte gegen eignen Wunsch handeln. - Ich hoffe Sie sollen mir weiter gut sein, wenn ich meinen Jungen zu einem brauchbaren Physiologen zu erziehen suche; er ist schon in die Naturforscher-Welt aufgenommen, den Leuckart dadierte ihm letzthin 1 Exemplar seiner vergleichenden Physiologie!
Die Untersuchungen von Husson werde ich mit Ihrer Erlaubniß in Kürze im Archiv mittheilen...
Moleschatt schickt mir gestern einen Abdruck zweier Abhandlungen aus der „Wiener medicin[ischen] Wochenschrift“ 12. März u[nd] 2. April d[ieses] J[ahres] über Betheiligung der Leber am
Bildungsprozeß der Blutkörperchen und am Rückbildungsprozeß des Nahrungsmaterials, die ich in Ihrer Beachtung empfehlen zu dürfen glaube. Es war für mich von hohem Intereße, daß er bei
entleberten Fröschen Oxalsäure im Muskelfleisch und Harn fand - eine Thatsache, die im schönsten Einklang mit meiner Theorie über die Oxalurie steht. Ich habe Ihnen doch meine
„Entwicklungsgeschichte der Oxalurie“ übersandt?? Sollte es nicht sein, so bitte ich um ein Wort, damit ich das Versäumte nachhole.
Mit aufrichtiger Ergebenheit
Ihr stets dankbarer
Hannover d. 19. April 1853 Dr. Beneke“
Oldenburg
Während seiner Zeit als hannoverscher Badearzt in Bad Rehburg (1852/53) kam Friedrich Wilhelm Beneke in nahe persönliche Beziehungen zu dem in Bad Rehburg residierendem Hof. Im Herbst 1853 wurde er zum Leibarzt des Großherzogs Nikolaus Friedrich Peter II. von Oldenburg (03.07.1827 - 13.06.1900; Großherzog vom 27.02.1853 bis 13.06.1900) ernannt. Die bis dahin kleine Familie Beneke zog in die Stadt Oldenburg.

Oldenburg (Stich um 1580)
Die Grafen von Oldenburg, deren Stammgebiet das Ammerland war, wurden Mitte des 12. Jahrhunderts erstmals erwähnt. Sie erwarben das Stedingerland (1260) und mehrere friesische Gebiete, zuletzt 1575 die Herrschaft Jever, und führten die Reformation ein. Nach Aussterben der gräflich Oldenburger Linie (1667) kam die Grafschaft zu der königlich-dänischen Linie, deren Stammvater Christian I. im Jahre 1460 auch zum Landesherrn von Schleswig-Holstein gewählt worden war. Von der dänischen Hauptlinie zweigten sich die Gottorper und die Sonderburger Linie ab. Die Gottorper Linie regierte bis 1773 in einem Teil Schleswig-Holsteins. Ein Sproß dieser Linie bestieg 1762 als Peter III. den russischen Thron. Ein Oheim Peter des III., Adolf Friedrich, wurde 1751 König von Schweden. Ein anderer Oheim Friedrich August (1711 - 1785) wurde 1773 zum Herzog des neugeschaffenen Herzogtums Holstein-Oldenburg mit Sitz in Eutin ernannt. Nach Friedrich August herrschte sein Sohn Peter Friedrich Wilhelm (1754 - 1829). Infolge seiner Unzurechnungsfähigkeit wurde jedoch sein Vetter Peter Friedrich-Ludwig (17.01.1755 Riesenburg - 21.05.1829 Wiesbaden) Regent an seiner Seite. Herzog Peter Friedrich Ludwig (Herzog von 1785 bis 1829) verlegte die Hauptresidenz von Eutin nach Oldenburg, wo er 1792 eine öffentliche Bibliothek gründete Eutin blieb Sommerresidenz. Dieser Herzog wurde der eigentliche Begründer des modernen oldenburgischen Staates.
1803 wurde das Herzogtum durch das hannoversche Amt Wildeshausen, die münsterschen Ämter Vechta und Cloppenburg sowie das Fürstentum (Fürstbistum) Lübeck vergrößert. Von 1810 bis 1813 wurde es dem napoleanischen Kaiserreich einverleibt. Nach dem Wiener Kongreß 1814 wuchs Oldenburg sogar zum Großherzogtum. Auf Peter Friedrich Ludwig folgte der Großherzog Paul Friedrich August (1783 - 27.02.1853; Großherzog vom 28.05.1829 bis 27.02.1853). Zwischenzeitlich wurde das Fürstentum Birkenfeld im Nahetal (1815) erworben, Jever (1818) und Kniphausen (1854) wurden zurückerworben.
Großherzog Nikolaus Friedrich Peter II., dem Friedrich Wilhelm Beneke als Leibarzt diente, trat 1854 dem deutschen Zollverein bei und schloß sich Bismarck an. Sein Nachfolger, Großherzog Friedrich August (16.11.1852 Oldenburg - 24.02.1931 Oldenburg; Großherzog vom 13.06.1900 bis 11.11.1918), verzichtete 1918 auf den Thron, Oldenburg wurde ein Freistaat. Dieser Kleinstaat blieb bis zum Zweiten Weltkrieg teilweise eigenständig.
Die Stadt Oldenburg wurde erstmals 1108 erwähnt. Etwa 5 000 Einwohner lebten in ihr zu Beginn des 19. Jahrhunderts, 20 000 zur Zeit der Reichsgründung. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach hatte die Stadt 75 000 Einwohner.
In einem Brief aus Oldenburg an Rudolph Wagner vom 20. März 1854 übte Friedrich Wilhelm Beneke u. a. Kritik an den Ärzten, Kliniken und der Ausbildung der Studenten, schrieb aber auch kurz über
seine Tätigkeit am Hofe und seine Praxis (Schmitter, 1986):
„... Was Sie über Hannover sagen, muß ich durchaus bestätigen, und ziehe ich eine Parallele zwischen hier und dort, so finde ich hier bei Weitem mehr Eifer und wißenschaftliches Intereße. Weil eben das letztere in H[annover] fast durchweg auf sehr geringer Stufe steht, ist auch das collegialische Leben dort ein sehr wenig Erfreuliches, Eifersüchterleien, egoistische Tendenzen, Mangel einer wißenschaftlichen Verständigung, bitterste Kritik auf der Seite der tüchtigen Leute und Indolenz auf Seite Anderer, das sind die traurigen Blüten, die das ärztliche Wesen dort trägt. Es fehlt ganz an einer Autorität, an einem Rathgeber und Freund für junge Ärzte namentlich und so geht jeder seinen eigenen Weg, nur zu bald mit hintenansetzung aller collegialischen Rücksicht. Es thut mir wehe über mein specielles Vaterland so sprechen zu müßen: aber es ist Wahrheit, was ich sage, und die eigne Erfahrung ließe mich noch manche Beweise dafür liefern. –
Ich selbst habe damals unter manchen älteren Aerzten namentlich viel Freundschaft und Liebe gefunden und muß dankbar dafür sein, aber mein inniger Wunsch, mit den Altersgenoßen einen anregenden wißenschaftlichen Verkehr anzuknüpfen, ist stets ein desiderium geblieben, und, wenn ich davon sprach, hat an die Achseln gezuckt oder gelacht.
Ich fürchte, da ich die heranwachsende Generation kenne, daß noch manches Jahr vergehen wird, ehe die Zustände sich ändern, noch wenig Jahre, und eine ziemlich große Negation aller praktisch-ärztlichen Wirksamkeit, die Wiener Schule zum Excess getrieben, wird das Ruder in der Hand haben.
Ein entmuthingdes Vorbild für die jüngere Nachkommenschaft! –
Aber sind nicht die Verhältniße an manchen Orten der Art? - - Ich hoffe am meißten von einer gründlichen Reform mancher unserer deutschen Kliniken. - Werden dort erst die Studierenden
angeleitet, sich selbständig über Aetiologie und Wesen der Krankheitsprozeße eine klare Anschauung zu verschaffen, durch Studien des Stoffwechsels, durch exacte physiologische Beobachtung, durch
Fertigkeit in der o(p)pertunen physikalischen Untersuchung, dann wird ihnen bald doch die feste Zuversicht erstehen, daß es dennoch eine Therapie giebt, daß der praktische Arzt kein überflüßiges
Subject ist; sie werden den Weg für die therapeutische Forschung erkennen und mit dem Studium der Wirkungsweise der einzelnen Heilmittel sich bald eine feste Basis für ihr Handeln gewinnen. Dazu
behilflich zu sein, sollte jedes klinische Institut mit einem chemisch-pathologischen Laboratorium verbunden sein; Körpergewichts-Waagen, chemische Apparate, u. s. w. dürfen da nicht fehlen und
jeder Studierende sollte mit ihrer Anwendung vertraut sein. Er kennt dann wenigstens den richtigen Weg der Beobachtung, und bringt ihn das Schicksal u[nd] seinen Berufskreis, wo er denselben
nicht mit der wünschenswerthen Sorgfalt verfolgen kann, so ist die Kenntniß einer Lücke in dem Beobachtung(s)-Resultat, ja schon die Kenntniß der für die Kritik eines Falles erforderlichen
Fragen, ein großer Gewinn und eine Bedingung für das praktische Urteil. Und wie Vieles kann an dem klinischen Institute selbst geleistet werden, wenn die jungen Kräfte richtig genutzt werden. Wie
manche hübsche Dissertation ist schon durch Vogel´s Anregung in den letzten Jahren hervorgegangen? Aber freilich, wenn die Studierenden die praktischen Collegien überlaufen, ehe sie sich in den
Grundlagen alles ärztlichen Wißens u[nd] Handelns festgesetzt haben, dann wißen sie nicht, wozu die genaue kleinste Forschung dienen soll. Sie lernen Recepte schreiben und schreiben ihr Leben
lang Recepte.
Doch ich darf Sie nicht länger aufhalten. Sie haben in Ihrem Briefe aber so manchen Gegenstand berührt, dem ich in der letzten Zeit oft nachdachte, daß ich nicht umhin konnte, mich
auszusprechen. Im Herbst hoffe ich, so Gott will, bestimmt nach Goettingen zu kommen. Im Mai muß ich den Herrschaften nach Eutin [Sommerresidenz des Großherzogs] folgen, bleibe Juni u[nd] July
hier und gehe im August wieder nach Wangerooge, wo die Frau Großherzogin baden soll.
Meine Praxis nimmt jetzt schon, ich möchte sagen leider !, so zu, daß sie mich am eifrigen Verfolgen meiner Arbeiten hindert. Nur die Abende stehen mir noch ganz zu Gebote und da ist´t leider
mit chemischen Arbeiten nichts. Es steckt mir ein Plan zu einer medizinischen Propädeutik, (...), allgemeine Therapie u[nd] Pathologie im Kopfe, den ich vielleicht, trotz aller Mängel des
Materials, ausführe! Aber jede Zeile ruft mir ein „Nonum (...) in annum“ ins Gedächtniß.
Nochmals herzlichen Dank für Ihren Brief, und die Bitte um Erhaltung Ihres Andenkens!
Mit steter Hochachtung
Ihr treuergebener
F. W. Beneke“
In Oldenburg hielt F. W. Beneke auch öffentliche Vorträge für Freunde der Naturwissenschaften: „Physiologische Vorträge“, welche 1856 gedruckt erschienen (Beneke, 1856). Er setzte sich für ein
Kinderkrankenhaus in Oldenburg ein, und spendete dafür das Geld, das er für seine öffentlichen Vorträge erhielt. Von verantwortungsbewußten und hilfsbereiten Bürgerinnen und Bürgern der Stadt
Oldenburg wurde im Jahre 1870 der Verein der Freunde des Elisabeth-Kinderkrankenhauses gegründet mit dem Ziel, ein Kinderkrankenhaus zu errichten und zu erhalten. Gefördert durch die Großherzogin
Elisabeth und mit finanzieller Unterstützung vieler Oldenburger begann bald darauf der Bau eines zweistöckigen Hauses neben dem Peter-Friedrich-Ludwig-Hospital. Im Juli 1872 öffnete das
Elisabeth-Kinderkrankenhaus, das nach den Plänen von Ludwig Klingenberg gebaut worden war, als eine der ersten deutschen Kinderkliniken seine Pforten. Auch wenn das Kinderkrankenhaus erst 1872
eröffnet wurde, als Friedrich Wilhelm Beneke schon längst in Marburg war, war dies eines seiner großen Verdienste, da er sich erstmals schon in den (18)50er Jahren für den Bau eines
Kinderkrankenhauses einsetzte und Geld dafür spendete.
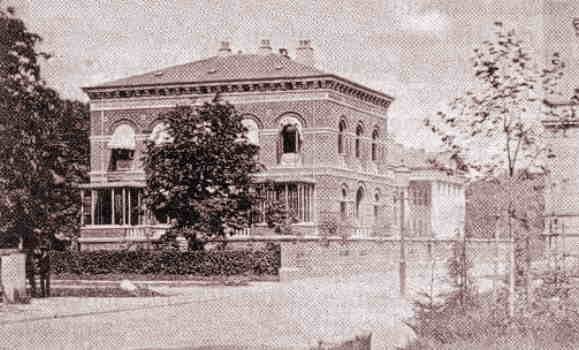
Elisabeth-Kinderkrankenhaus in Oldenburg (um 1878)
Bis nach dem 1. Weltkrieg gelang es dem Trägerverein, den Betrieb des Kinderkrankenhauses mit Spenden aufrechtzuerhalten. Dann wurden zunehmend staatliche Zuschüsse notwendig. 1934 wurde die
Klinik in den Betrieb des staatlichen Peter-Friedrich-Ludwig-Hospitals eingegliedert, der Verein aufgelöst. 1938 übernahm die Stadt Oldenburg beide Krankenhäuser. Als nach dem 2. Weltkrieg durch
den Flüchtlingszustrom die Bevölkerung der Stadt Oldenburg stark anwuchs, wurde das alte Kinderkrankenhaus zu eng. Die Stadt erwarb das ehemalige Offiziersheim an der Cloppenburger Straße. Dieses
wurde aufgestockt und durch den Anbau einer Infektionsstation erweitert. Seit Mai 1953 dient dieses Gebäude als Kinderklinik.
F. W. Beneke hatte als Leibarzt des Großherzogs Nikolaus Friedrich Peter II. von Oldenburg die Gelegenheit zu Reisen nach Nauheim, zur Insel Wangerooge und zur Insel Wight. In dieser Zeit schrieb er ein kleines Buch „Über die Wirkung des Nordseebades“ (Beneke, 1855), ein Thema mit dem er sich wenige Jahre vor seinem Tod eingehend beschäftigen sollte. Mit der Beschreibung der Wirkung von Nordseeluft auf den Stoffwechsel und seinem späteren Wirken in Nauheim als Badearzt sowie durch weitere balneologischen Schriften erreichte F. W. Beneke erhebliche Fortschritte auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Balneologie (Beneke R., 1939; Schmitter, 1986).
In einem weiteren Brief aus Oldenburg an Rudolph Wagner berichtet Friedrich Wilhelm Beneke einiges über sein Leben in Oldenburg und über die Wissenschaft (Schmitter, 1986):
„Oldenburg, 21. Okt[ober]1855
Hochgeschätzter Herr Hofrath!
Ich erlaube mir, Sie mit einer großen Bitte zu belästigen.- Ich weiß nicht, ob ich Ihnen schon mittheilte, daß ich hier im vorigen Winter eine Reihe populärer-physiologischer (freier)
Vorträge hielt, die einem zahlreichen Publikum (ich hatte 150 Zuhörer) Freude zu machen schien. Nach langem Wiederstreben habe ich der Aufforderung Folge geleistet, dieselben niederzuschreiben
u[nd] zwar so, daß sie allen Freunden der Naturwißenschaften verständlich, vor Allem aber angehenden Medicinern eine Propaedeutik sein können [Beneke, 1856]. Der erste Band erscheint in etwa 8
Tagen u[nd] ich bedaure nur, daß mir nur sehr wenige Exemplare zu Gebote stehen, da ich Ihnen sonst ein solches gesandt haben würde, mit der Bitte mir Ihre Ansicht über das Ganze mitzutheilen.
Sollte sich mein Verleger noch nachträglich erweichen laßen, so werde ich einen gern gehegten Wunsch erfüllen.
Ich bin gegenwärtig mit der Bearbeitung des 2ten Bandes mit Bau und Lebenserscheinungen der Thierwelt beschäftigt. Da ist mir dann sehr um Ihre trefflichen Iconer Zoologie zu thun u[nd]
leider kann ich diese hier und in der Nähe nirgends bekommen, scheue auch bei den theuren Zeiten die Ausgabe für die Anschaffung. Hätten Sie nun vielleicht die große Freundlichkeit, mir das auf
der dortigen Bibliothek befindliche Exemplar oder ein eigenes auf etwa 3 Monate zur Benutzung zu übersenden? Es würde mir damit eine große Beihilfe gegeben werden, um so mehr als das Werk mit
zahlreichen Holzschnitten erscheint; zum Voraus schon auf alle Fälle meinen besten Dank. Sie sahen im verfloßenen Sommer meinen alten Schwiegerpapa [Georg Friedrich Sengstack (1779 - 1855)]. Er
ist leider wieder sehr leidend u[nd] die hydrogischen Erscheinungen (cirrhosi Hepatitis) [Leberzirrhose] stellen sich von Neuem ein... Er sagte mir kürzlich, daß Sie auch von meiner Berufung nach
Giessen gesprochen, daß ich mich über die mir unerwartet gegebenen schönen Aussichten auf Erfüllung eines lang gehegten Wunsches sehr gefreut habe, werden Sie nicht bezweifeln, um so mehr als das
Hofleben und die Praxis mich gar zu sehr an der Arbeit, wie ich sie mir wünsche, hindern und namentlich ersteres mir sehr wenig zusagt. Mit noch größerer Freude erfuhr ich bald, daß die Facultät
mich primo loco beim Ministerium vorgeschlagen haben. Leider aber höre ich letzthin, daß persönliche Intereßen meine Berufung zweifelhaft gemacht haben u[nd] so sitze ich noch in einer sehr
unangenehmen Spannung... Sollte es wahr sein, was mir allerdings aus manchen Mittheilungen hervorgeht, daß Fuchs [Konrad Heinrich Fuchs (1803 - 1855)] meine Berufung widerrathen habe?? - Nun, ich
muß jedes Urtheil bei solcher Lage über mich ergehen laßen; ich halte es für Unrecht in das Rad des Schicksals einzugreifen, u[nd] würde es eine Unbescheidenheit nennen, eigene Schritte um die
Erwarung einer Stelle zu thun, zu deren vollkommener Ausfüllung gewiß beßere Kräfte zu finden sind. In all meinen Lebensveränderungen habe ich an jenem Prinzip festgehalten u[nd] habe doch viele
Ursache Gott zu danken.
Mit Leuckart habe ich in letzter Zeit im Betreff einiger allgemeiner physiologischer Fragen correspondiert; ich freue mich immer über seine trefflichen Kenntnisse und seinen großen Fleiß. Wie
viel mehr würde ich mich noch freuen, mit meinen alten Freunden wieder an einem Orte arbeiten zu können! - Vogel wird wie ich höre, den Winter hindurch noch in Giessen docieren, während seine
Familie schon in Halle ist; er ist sehr unglücklich über die endlose Verzögerung im Betreff der Berufung seines Nachfolgers. –
Nochmals bitte ich um Verzeihung meines Anliegens mit der Bitte um eine Empfehlung an Ihre Frau Gemahlin und mit den besten Wünschen für Ihr eigenes Wohlergehen bleibe ich
Ihr stets dankbarer Schüler
Beneke“
In einem Brief aus Oldenburg vom 1. November 1855 an Justus von Liebig, schrieb Friedrich Wilhelm Beneke ebenfalls über seine Berufszukunft u. a. (Schmitter, 1986):
„... Daß die Facultät in Giessen mir die unerwartete Ehre erzeigt hat, mich zu Vogel´s Nachfolger vorzuschlagen, ist Ihnen vielleicht bekannt geworden. Ich weiß nicht, wie es um die Sache steht, habe aber meinerseits, so gerne ich dem Rufe folgen würde, keine Schritte gethan; sollte man sich in Darmstadt gegen die Facultät entscheiden, so würde ich zwar nicht unglücklich sein, aber doch bedauern, den mit Vogel gehegten Wunsch, der naturwißenschaftlichen Richtung in der klinischen Forschung mehr und mehr Vorschub zu leisten, unerfüllt zu sehen. Hier bin ich leider! auf ein sehr unbedeutendes Material und auf mich selbst beschränkt.“...
Oldenburg mit dem Wahrzeichen Lappan (um 1900)
In einem Brief vom 5. Dezember 1855 an Rudolph Wagner schrieb Friedrich Wilhelm Beneke u. a. (Schmitter, 1986):
... „Mit tiefer Bewegung habe ich heute Morgen den Tod meines immer hochgeschätzten Lehrers u[nd] Freundes Fuch(s) [Conrad Heinrich Fuchs] erfahren! Harmonierten wir auch in der letzten Zeit nicht ganz im Betreff deßen, was die Medizin gegenwärtig erfährt, ich habe Fuch(s) unendlich geachtet und geliebt u[nd] bin augenblicklich wahrhaft erschüttert über den Verlust, den so viele u[nd] ich mit ihnen erlitten. Laßen sie mich deshalb heute nur noch einen herzlichen Gruß hinzufügen, da mir zu Mehrerem die Ruhe und Sammlung fehlt. Ich fühle mich gedrungen der Witwe des Verblichenen noch einige Zeilen zu schreiben.
Hochachtungsvoll
Ihr treu ergebenster
Beneke
Friedrich Wilhelm Beneke bekam den in den Briefen erwähnten Ruf an die Universität Gießen nicht und weilte weiterhin in Oldenburg. Von dort schrieb er im Mai 1856 einen Brief an Rudolph Wagner (Schmitter, 1986):
„Oldenburg, 19. Mai 1856
Hochverehrtester Herr Hofrath!
Mit dem herzlichsten Dank schicke ich Ihnen beifolgend Ihre trefflichen (Iconer) Zootomi(r)ae zurück, und muß nur um Entschuldigung bitten, daß ich so lange damit säumte. Die Ausarbeitung des
2 ten Bandes meiner „physiol[ogischen] Vorträge hat mir aber bei Weitem mehr Mühe gemacht, als ich dachte, und bei ausgedehnter praktischer Beschäftigung konnte ich nur langsam
fortschreiten.
Ich schreibe Ihnen heute als an einem Tage, wo ich mich für 10 Wochen von Oldenburg trennen muß.
Unser Erbprinz sowohl, wie die Frau Großherzogin bedürfen einiger Bäderkuren, und ich gehe mit Ihnen zunächst nach Nauheim und später ins Seebad.
Am Mittwoch werde ich Goettingen genißen und meiner unvergeßlichen dort erlebten Jahre dankbar gedenken! Leider wird mir zum Aufenthalt keine Zeit gelaßen.
Sind Sie nicht böse, wenn ich in dem trouble der heutigen Reisevorbereitungen weitere Mittheilungen unterlaße.
Ich kann nur wünschen, daß es Ihnen und den verehrten Ihrigen eben so wohl geht, als mir u[nd] den Meinigen und bitte um eine herzl[iche] Empfehlung an Ihre Frau Gemahlin.
In dankbarer Hochschätzung
Ihr stets ergebener
Beneke“
Auf einer Reise mit „distinguished persons“ auf die Isle of Wight schrieb F. W. Beneke an Karl Victor Klingemann nach London einen Brief (Schmitter, 1986):
Bonchurch (Ile of Wight, um 1850)
„Bonchurch, Isle of Wight, 11. Juli 1856
Mein hochverehrtester und lieber Freund!
Es wird Ihnen kaum glaublich erscheinen, daß ich Ihnen so nahe bin, als es der Poststempel meines Briefes angiebt; aber es ist dennoch Wahrheit, daß ich seit 14 Tagen auf englischem Grund und
Boden stehe, und zwar auf der Insel Wight, in dem reizendem Bonchurch. Ich bin hier in Begleitung einiger „distinguished persons“, welche die Seebäder gebrauchen! Weiteres zu sagen ist mir leider
verboten, und Sie verzeihen meine Schweigsamkeit. Aber das darf und will ich doch sagen, daß es mich unendlich zu Ihnen, meinem theuren Freunde hinzieht, und daß ich tiefes Bedauern empfinde,
über die ferner wirkende Wahrscheinlichkeit, Sie persönlich aufsuchen zu können. Um so mehr jedoch nur greife ich jetzt zur Feder! Ich muß Ihnen sagen, wie unendlich schmerzlich mich das trübe
Schicksal berührt hat[1] , welches Ihnen der Himmel gesandt hat, und wahrlich ich konnte mich der tiefsten Bewegung nicht verwehren, als mir die Hannoversche Zeitung, und gleich darauf Benecke´s
von Champios Hill - die ich in Nauheim bei Frankfurt zu sehen die Freude hatte, - die traurige Nachricht enthüllten! - Sie lieben, prächtigen Menschen! Wie begreife und fühle ich Ihren Schmerz! -
Selbst im glücklichen Besitz prächtiger Kinder vermag ich mir jetzt auszumalen, was es heißt ein Kind hergeben müßen - und doch ist der Schmerz gewiß noch 100 fach größer, als man sich denkt und
ausmalen kann. - Ich weiß es ja, was Fritz´chen Ihnen war, ich kannte ihn selbst u[nd] hatte ihn lieb; ist es nicht schwer, in solchen Zeiten festzuhalten an dem Glauben einer uns ewig leitenden
Liebe? - Und doch ist sie da! - und je älter meine Erfahrungen werden, um so öfter sagen sie mir, daß sie da am härtesten schlägt, wo die christlichste und reinste Gesinnung und Tugend zu finden
ist! –
-------------
[1] Tod des Sohnes Fritz Klingemann
-------------
Ich lese während meines hiesigen Aufenthaltes den 3. Band von Pert(ho) Leben! Ein herrliches Buch, - das Sie sich anschaffen müßen. Ich kann es nicht unterlassen, Ihnen eine Stelle daraus
mitzutheilen, welche Pertho einem Freund schrieb, als er ihm die Anzeige von dem Tode seines Sohnes machte: „Was es heißt“ schreibt Pertho, „ein Kind zu verlieren fühlt Niemand, der es nicht
erfahren hat; Jeder sieht von Kindesbeinen an, daß das Zerreißen der Liebe keinem Menschen erspart wird, aber was hilft das dem betrübten Vater und der betrübten Mutter. Claudius sagte einmal:
ich dachte lange schon, mein Glaube sei fest u[nd] stark, in der Stunde also, in der ich meinen Matthias in den Sarg legte, da wollte Ergebung und Demuth fast nicht halten und der Glaube ward
hart geprüft; da erst lernte ich verstehen, was es mit dem Menschenleben auf Erden auf sich hat, was vorherging, war nur ein Kinderspiel. Haltet im Schmerze fest aneinander, fuhr Perthes fort,
verberge ihn keiner dem Anderen, versucht nicht einander zu beruhigen, laßt zusammen ausschmerzen, das gibt stille „Freudigkeit“ und vermählt Euch so enge, wie Glück allein Euch nicht vermählen
könnte. Haltet fest aneinander, Ihr lieben Freunde, die Gemeinschaft der Liebe macht den tiefsten Schmerz zu einem Segen Gottes.“ -
Kennen Sie diese Worte nicht, so werden sie Ihnen gewiß zur Erhebung u[nd] Freude gereichen, u[nd] kennen Sie sie, so lesen Sie sie noch einmal mit dem Gedanken, daß es die Worte sind die
Ihnen gleich hätte zurufen mögen, als ich von Ihrem Trauerfall hörte. - Gebe Gott Ihnen Kraft, ein hartes Geschick zu tragen; die viele u[nd] reiche Liebe Ihrer Freunde muß Ihnen eine Stärkung
sein.
Wie gerne ich Sie in diesen Zeiten selbst sähe, brauche ich gar nicht zu sagen. Ich hege nur noch eine leise Hoffnung, daß ich vielleicht Ende nächster Woche auf einen Tag hinüberkommen kann
- und da würde ich Sie vielleicht am sichersten bei Benecke´s (am Sonnabend) finden?? - Schreiben Sie mir ja, ob Sie in London sind - und wo ich Sie etwa treffen kann. –
Needles (Westküste der Isle of Wight, um 1850)
Seit 7 Wochen schon bin ich von Frau, Kinder und Haus getrennt. Erst Anfang August werde ich wieder in Oldenburg sein. - Wie lang und schwer wird eine solche Zeit, die mich, wenn sie auch
manches Intereßante und Schöne bietet, doch in einer gänzlichen kalten und oberflächlichen Umgebung zu leben heißt! - Wie sehne ich mich nach Frau und Kindern! - Freilich ist auch diese Zeit
hoffentlich ein Segen für uns Alle. Nach sehr angestrengter Arbeit bedürfte ich einer längeren Ausspannung und meine liebe Frau war durch viele Schicksalsschläge nächster Verwandter u[nd]
liebster Freunde, so wie durch eine gefährliche Krankheit unseres Zweiten Söhnchens so angegriffen, daß ich sie für 4 Wochen nach Norderney geschickt habe, wo sie, so Gott will, Kraft und Frische
wiedererlangt. Der August führt uns hoffentlich wieder zusammen und die Freude darauf ist unendlich groß. Was kann es Schöneres auf dieser Welt geben, als ein glückliches eheliches Leben! Alles
theilt man, nichts verbirgt man sich, das Herz entflammt frei auf und um so freier, als es im alltäglichen Leben nur zu oft Feßeln fühlt, die ihm leidige Verhältniße u[nd] traurige
Menschlichkeiten anlegen! –
Die Zeit der Ausspannung war übrigens keine ganz ungestörte für mich. Am 2. Tages meines Verweilens in Nauheim erhielt ich von der heßischen Regierung einen Antrag als Professor nach Marburg zu kommen und im Sommer als erster Badearzt in Nauheim zu leben! Gänzlich unerwartet wie der Antrag war, hat er mich in nicht geringstem Maaße aufgeregt. Doch allmählich ist Ruhe eingetreten, und ich warte jetzt der Entscheidung von Cassel aus. Ich verlaße Oldenburg zum Theil sehr ungern. Ich habe dort in kurzer Zeit viel Freud, viel Liebe, viel reges Streben gefunden. Aber die Feßeln des Hoflebens, dies Scheinwesen, werfe ich gern von mir, und gerne trete ich in einen Berufskreis ein, in dem ich freier und ungebundener meinen Studien und meinem Berufe selbst leben kann, in dem ich namentlich nicht alljährlich auf längere Zeit von meinen Liebsten getrennt werde und obendrein eine sorgenfreie Existenz erhalten werde!
So laßen Sie mich dann vielleicht schon im nächsten Winter nach dem schönen Marburg übersiedeln, wenn ich auch selbst noch Zweifelhaft bin, da mein gnädigster Herr mich schriftlich
seines Wunsches versichert hat - mich zu behalten. –
Zu meiner großen Freud sah ich in Nauheim Alfred u[nd] Adelheid B[enecke]. Sie machten mir diese Freude in unvergeßlicher Weise. Einen halben Tag hielten sie sich dort auf. - Mir zu schnell
ging die Stunden hin! - Wie glücklich macht mich noch stets die Erinnerung an meine in England erlebten Jahre, und alle Liebe die ich dort genoßen! Und nun ich Ihnen allen so nahe bin, wie gerne
möchte ich Ihnen Allen von Herzen dafür noch einmal danken! - Ganz gebe ich die Hoffnung noch nicht auf - aber sie ist Schwach! - Grüßen Sie inzwischen alle meine Freunde, die Sie etwa sehen,
komme ich, so gebe ich noch eine kurze Nachricht.
So leben Sie denn wohl, für heute, mein lieber, bester Freund! - Gott sei mit Ihnen u[nd] Ihrer theuren Frau! Möchten Ihnen meine wenigen Zeilen ein Beweis meiner treuen Anhänglichkeit sein
und möchten Sie Ihnen sagen, wie ich von Herzen Theil nehme, an Allem was Ihnen Gott sendet! - Aufrichtig bleibe ich stets
Ihr Beneke“
Dieser Brief zeigt auf, daß F. W. Beneke dem oberflächlichen Hofleben und den damit verbundenen Reisen nicht viel abgewann und viel lieber bei seiner Familie gewesen wäre. Der Antrag der
hessischen Regierung als Professor nach Marburg zu kommen und Badearzt in Nauheim zu sein, kam seinem Wunsche des weiteren Studiums in der Medizin aber auch einer sorgenfreier Existenz und
Zukunft näher.
In einem weiteren Brief vom 7. Januar 1857 an Rudolph Wagner berichtet Friedrich Wilhelm Beneke etwas aus seinem Privatleben, aber auch über die Wissenschaft (Schmitter, 1986):
... „Außer für meine an einer hartnäckigen Ophthalmie [Augenentzündung] leidende Frau hatte ich für meinen in Melancholie versunkenen und bei mir Auffrischung suchenden fast 70 jährigen Vater
[Georg August Beneke (1788 - 1858)] zu sorgen: das Fest verfloß trübe - und das Neujahr hat damit begonnen, daß ich den guten Papa auf eine Zeit lang zu Dr. Engelken gebracht habe, wo er
richtiger und beßer gepflegt werden kann, als in meinem Hause. Ich hoffe von dem dortigen Aufenthalt das Beste, und nicht ohne Grund, da das Leiden sich rasch entwickelt hat und um so eher der
Heilung zugänglich wird“.
„... Was mir für unseren Verein [Verein zu gemeinschaftlichen Arbeiten für die wissenschaftliche Heilkunde] leid ist, ist das, daß Vogel und Nasse mich so wenig unterstützen. Ich habe alle
Arbeit fast davon, während dieselbe doch als das Resultat der vereinten Bestrebungen von uns dreien der Welt vorgeführt wird, - daß Vogel mit seinem prächtigem Gemüth und seinen trefflichen
Kenntnißen in Halle nicht (...), ist mir sehr erklärlich. Es fehlt ihm die praktische ärztliche Erfahrung, er vergißt wie ich glaube, am Krankenbette oft, daß er junge Leute nicht nur für die
Wißenschaft, sondern auch für das praktische Leben und dafür zunächst bilden soll. Darin war ihm sein Vorgänger voraus; wenn auch - will man einmal einseitig verfahren, der Weg Vogel´s noch bei
weitem werthvoller ist. Es ist die schwere Aufgabe des Klinikers, die Bedürfniße der Praxis und die Anforderungen der Wißenschaft den Schülern klar zu machen - und gute Kliniker sollten sich
längere Zeit im praktischen Leben selbst umgesehen haben; sind dann die Anforderungen der Wißenschaft den Schülern verständlich, so werden sie sich - mit den Bedürfnissen der Praxis vertraut -
gern den tieferen Studien hingeben und so schafft der Kliniker mit seinen Schülern neue Thatsachen herbei: die Klinik wird von der Lehr- zur Studierstube. - Fehlte es Vogel nicht so sehr an
praktischem Talent, an Entschiedenheit, er würde unter den ersten Klinikern Deutschlands stehen -, jener Mangel quält mich oft, und zwar deshalb, weil ich Vogel so herzlich lieb habe und weil ich
weiß, daß unserem Verein damit sehr geschadet wird.-
Sie fragten freundlichst mich nach meinem eigenen Schicksal. Daß mir Giessen nicht zu Theil geworden, thut mir leid; ich danke es, wie ich bestimmt weiß den Bemühungen des Minist[ers] R.
Rieffel für seinen Neffen Dr. Seitz. Seitz ist aber ein strebsamer Mensch und hoffentlich wird er etwas Tüchtiges leisten. Jetzt ist mir ein neuer Antrag gestellt: ich sollte nach Nauheim als
Badearzt kommen und im Winter in Marburg docieren. Ich war bereit zu gehen. Wiewohl aber der Churfürst meine sämtlichen Bedingungen erfüllt hat, ist es ihm eingefallen, die angetragene Professur
in Marburg nachträglich zu streichen, er will mich nur als Badearzt engagieren. Diesen Antrag habe ich aber abgelehnt: - so sehr brillant auch die äußeren Verhältniße der Stellung sind, und kommt
der Churfürst nicht auf den anfängl[ichen] Antrag zurück, so bleibe ich in Oldenburg. - Ich lebe hier, wenn auch eingeschränkt, doch ohne große Sorgen. Bin für viel Liebe und vieles Vertrauen
dankbar, - trete bald in das Medicinal-Colleg. Bin ferner als Beirath in Medicinal-Angelegenheiten bei Königl[ich] Preuß[ischem] Admiralitäts-Commißariate hierselbst angestellt, - ein
Wirkungskreis, für den ich Gott dankbar bin. Sollte ich ihn gegen die Stellung eines Badearztes eintauschen, gegen vieles Geld und wenig Befriedigung für Herz u[nd] Kopf? - Nimmer.
Die ruhigste Ueberlegung hat mich bald zu der Ueberzeugung geführt, daß ein solcher Wirkungskreis mein Glück nicht herbeiführt. - Sollte der Churfürst noch auf die anfängliche Proposition
zurückkommen, dann ist´s etwas Anderes, - und dann allerdings gebe ich den Leibarzt gerne auf.
Von meinen gegenwärtigen Arbeiten kann ich Ihnen leider! nicht viel Erfreuliches sagen, da mich seit Mitte October Familienangelegenheiten fast jeder Ruhe beraubten. Auf der Naturforscher
Versammlung in Wien habe ich aber dennoch so viel Anregung und neue Frische gesammelt, daß ich jetzt bald mit neuer Lust beginnen werde, denn noch wenige Tage - und alle störenden Einflüße werden
beseitigt sein. Zunächst werde ich mich mit einer Arbeit zur Anbahnung einer wißenschaftl[ichen] brauchbaren Morbilitäts u[nd] Mortalitäts-Statistik für Deutschland beschäftigen - ich sammle
gegenwärtig das Material dazu - einen Abdruck der Arbeit werde ich Ihnen später zusenden [Beneke, 1857]. Dann habe ich ein sorgfältiges Studium der „pathologischen Physiologie“, von Dr. Spiess
vor - ein Buch, das mich im höchsten Grade intereßiert - wie ich glaube, jedoch, weil es hinter dem, was sein Titel besagt zurückbleibt. Von der Zeit, wo der Titel: pathol[ogische] Physiologie in
der Wißenschaft eingeführt ist, wird sich später eine neue Ära der Heilkunst datieren - aber was Spiess gegeben hat, ist nicht das, was unter „pathologischer Physiologie“ meines Erachtens
wenigstens, verstanden werden darf - und falls ich richtig vorausgesehen habe, muß Spiess´ertem Werk ein anderes folgen, welches dem inhaltsschweren Titel mehr zur Rechtfertigung gereicht. - Ob
ich jemals selbst Kraft und Zeit haben werde, an eine solche Arbeit zu gehen, weiß ich nicht. - Finde ich aber nicht die Gelegenheit Bausteine zu sammeln - an einer Klinik zu arbeiten, so will
ich meine Aufgabe darin suchen, die vorhandenen Thatsachen u[nd] Materialien zu bearbeiten und von dem Standpunkte der eigenen Erfahrung zu beleuchten. Ich wage es dann vielleicht darauf, und
nutzt der Welt die Arbeit wenig - so erhält sie mich selbst frisch! –
Doch ich finde gar kein Ende! - Verzeihen Sie, hochverehrter Herr Hofrath! - Ihr eigener lieber Brief gab mir Veranlaßung zu der langen Expectoration. - Ich würde mich freuen, wenn mich das
Schicksal einmal wieder nach Goettingen führte, damit ich mündlich Manches mit Ihnen besprechen könnte, was schriftlich zu weit führt.
Gebe Gott, daß es bald der Fall ist. Für heute sende ich Ihnen nur noch meine besten Wünsche zu dem neu begonnenen Jahre, für Sie und Ihr ganzes Haus - und mit der Bitte um eine herzliche Empfehlung an Ihre geschätzte Frau Gemahlin bleibe ich
Ihr stets dankbar ergebener
Beneke“
In einem Brief an Karl Victor Klingemann vom 13. März 1857 berichtet F. W. Beneke u. a. viel über seine Familie und seine berufliche Zukunft (Schmitter, 1986):
... „Was mich und meine oben erwähnte Stimmung betrifft, so betrübte mich einmal ein andauerndes Kränkeln meiner, lieben theuren Frau, das selbst einmal ernste Besorgniße erregte. Gott sei
Dank! Geht es aber gegenwärtig beßer. Sodann hatte ich um Weyhnachten die schwere Aufgabe, meinen gemüthskrank gewordenen Vater [Georg August Beneke (1788 - 1858)] von der Seite seiner Frau
[Caroline Artemisia Hansing (1795 - 1875)] in eine Heilanstalt bringen zu müßen, woselbst er noch verweilt. - Aber auch dieses Leid wird sich hoffentlich wenden. - Hoffentlich kehrt mein Vater im
April zu seiner Frau, mit der er jetzt allein lebt, zurück. –
Endlich haben mich die Hessen in einer Weise behandelt, die wohl nur in Hessen zu den Möglichkeiten gehört. Man offerierte mit schwarz auf weiß eine Professur in Marburg und die 1.st
Badearztstelle in Nauheim. Die Verhandlungen dauern ½ Jahr. Das Ministerium ist mit allen meinen Bedingungen zufrieden. Zum Schluß aber fällt es dem Khurfürsten ein, die Genehmigung zur Professur
zurückzunehmen, um auch im Winter meine Saison in Nauheim zu eröffnen, was beiläufig bemerkt, ganz unmöglich ist, falls nicht etwa die Bäder, wie in Wiesbaden, in den Logirhäusern gegeben werden
können. Ministerium u[nd] Khurfürst liegen nun ¼ Jahr wieder in Streit. Aber der Khurfürst besteht auf seiner Idee und mir wird geschrieben, der anfängliche Antrag habe nicht die höchste
Genehmigung gefunden! So behandelt der Herr seine Minister. - Ein trauriges Zeichen der Zeit! Doch auch das liegt hinter mir, und neuen Muthes voll habe ich hier meine Arbeit wieder begonnen! -
Ich danke jetzt Gott, daß er mich in einem Land gelaßen hat, wo Biederkeit, Zufriedenheit und Offenheit fast allgemeine Eigenschaften sind, und das Gefühl, die Liebe vieler Freunde zu besitzen
hat mir rasch ein heimathliches Gefühl dafür verschafft. Vom Hof freilich oder richtiger von dem ärztlichen Wirken bei Hof spreche ich nicht. Da bleibt Vieles zu wünschen. Aber inmitten meiner
Mitbürger lebe ich gern, und da ist mein Hauptfeld der Thätigkeit. -
Wie gerne spräche ich Sie einmal mündlich. Ausführlicher könnte ich Ihnen dann von unseren häuslichen Glücke, von unseren musikalischen Genüßen, von meinen literarischen Bestrebungen
erzählen. - Meine drei Kinder bereiten mir unendliche Freude - mit meiner lieben Frau lebe ich in einem Einverständniß, wie es nicht schöner sein kann. - Es wurde mir damals so schwer England zu
verlaßen. Als ich aber diesmal in London war, überwältigte mich das dortige Getreibe doch ganz und gar, und ich freute mich doppelt, daß mich das Geschick nach Deutschland zurückgeführt hatte. -
Die Aufgaben gerade des Arztes sind in London überaus schwierig und in so fern wenig befriedigend, als die weiten Entfernungen die eigentliche Thätigkeit meistens sehr beschränken. Ich hätte mich
dabei schwerlich wohl gefühlt. Auch Weber klagte mir in diesem Sinne seine Noth. - Nach dem deutschen Hospitale, dem ich so vieles verdanke, war mein erster Weg - und ich habe mich herzlich
gefreut zu erfahren, daß ich jetzt doch auch in den Augen meiner früheren Widersacher gerechtfertig dastehe! Sie werdendie Verhältnisse kennengelernt haben. - ...“.
Die im vorherigen Brief genannten Schwierigkeiten mit der hessischen Obrigkeit konnte F. W. Beneke beilegen. Die Kurfürstlich Hessische Regierung wurde nicht nur durch den nicht erfolgten Ruf von Friedrich Wilhelm Beneke nach Gießen aufmerksam, sondern auch durch seine balneologische Schrift (Beneke, 1855) und übertrug ihm im April 1857 die wissenschaftliche Ausnutzung der Nauheimer Solquellen. Mit seiner Anstellung als Erster Brunnenarzt in Nauheim wurde ihm der Titel des Kurfürstlichen Hessischen Hofrates verliehen. Gleichzeitig erhielt er einen Lehrauftrag für pathologische Anatomie an der Universität Marburg an der Lahn. Hier nahm die Familie Beneke auch ihren Wohnsitz ein. Damit erfüllte sich für F. W. Beneke zumindest ein erster Schritt in Richtung der akademischen Laufbahn zu. In Oldenburg hatte er noch Berufungen als erster Brunnenarzt nach Homburg und als Leibarzt der Königin von Preußen abgelehnt.
In einem Brief berichtet Friedrich Wilhelm Beneke an Rudolph Wagner, bereits aus Nauheim, wie schwer es ihm fiel aus Oldenburg wegzugehen (Schmitter, 1986):
„Nauheim, 20. Mai 1857
Hochverehrter und lieber Herr Hofrath!
Daß ich Oldenburg dennoch verlaßen habe, werden Sie gewiß schon erfahren haben. Aber ich kann mich doch der angehmen Pflicht nicht entsagen, es Ihnen zu constatieren. - Ich habe meine
Sommerthätigkeit in Nauheim bereits begonnen - und die academische Thätigkeit in Marburg steht mir für den Winter in Aussicht.
Sie werden begreifen, wie Vieles für mich zu thun war, nachdem ich Ostern den Entschluß faßte, einem zweiten Antrage der hessischen Regierung nicht länger zu widerstehen. Verzeihen Sie es
damit, wenn ich so lange mit meinem Briefe zögerte. Theils war aber auch meine ganze Stimmung Schuld an meinem Stillschweigen, denn ich muß offen gestehen, daß mich die Trennung von Oldenburg
einen schweren Kampf gekostet hat. Ich genoß im Kreise meiner Klienten dort eine Liebe, wie ich sie schwerlich jemals wiederfinden werde. - Der Ort selbst und das Leben waren mir lieb geworden -
meine Thätigkeit wurde eine immer größere, so daß leider! oft wochenlang an wißenschaftliche Beschäftigung nicht zu denken war. Also ein schwerer Druck laßtete beständig auf mir - es waren die
Hof-Verhältniße, die jedes ernsthafte ärztliche Streben zu Nichte machten, und doch das Opfer der Freiheit mit Strenge forderten. - Zu längeren Abwesenheiten auf Reisen u.s.w. war ich
verpflichtet, wurden diese erforderlich und sie würden es geworden sein - so war mein Gehalt zu klein, als daß ich damit hätte existieren können, und doch war mir die Möglichkeit des praktischen
Erwerbes abgeschnitten, wenigstens für eine gewiße Zeit. Trotz der dringendsten Vorstellungen von vielen Seiten wollte der Großherzog in dieser Beziehung keine Aenderung eintreten laßen - und
wiewohl er selbst mir stets Zeichen des größten Wohlwollens gab - mich auch schließlich als titul[ierter] Leibarzt beibehalten hat - so konnte er doch oder wollte er „der Observanz“ wegen, meine
Stellung nicht sicherer machen. Diese Umstände und die Neigung, der wißenschaftlichen Laufbahn näher zu treten, haben mich dann rasch meinen Entschluß faßen laßen - und ich hoffe zu Gott - daß
ich das Richtige gewählt habe. Es wird mir zunächst noch recht schwer, mich in die fremde Welt zu finden. - Aber ich glaube, mit der Zeit wird meine Stellung eine recht angenehme werden und auch
geistig wird sie mich befriedigen. Die Lage und die Quellen Nauheims sind prächtig - die Bedeutung des Ortes wird immer größer, - die genaue Feststellung der Wirkungen des Bades habe ich mir als
nächste Hauptaufgabe vorgestellt [Beneke, 1859]. Und wenn ich dazu bedenke, daß man durch redliches Streben für das Wohl seiner Mitmenschen sich überall Freunde und dankbare Herzen erwarten kann,
so wird ja auch hier der das Gemüth befriedigende Gewinn nicht fehlen. In die Zukunft sehe ich noch mit unklarem Blick. Sehe ich ein, daß sich beide Stellungen nicht gut miteinander vereinigen
laßen, so entschließe ich mich vielleicht früher oder später einmal ganz hier zubleiben - und in der Errichtung einer Privat-Klinik für scrophul[öse] Kranke meine Aufgaben suchen. - Ich bitte Sie
jedoch über diese Intention nicht weiter zu sprechen, da sie noch durchaus nicht fest steht. - Ihre Ansicht darüber zu erfahren, wäre mir aber doch eine große Freude. Fühle ich mich dagegen durch
die academische Thätigkeit in dem Grade angezogen, daß ich darin mein Glück suchen darf, so(weit) ich mit aller Kraft meiner weiteren Ausbildung zum Kliniker entgegenstreben. Frau und Kinder,
meine kleine Welt, durch die Gott mich mich unendlich beglückt, habe ich gleich mitgebracht. Das fremde Land wird dadurch leichter zur Heimath. - Herrliche Spaziergänge, die ich allabendlich mit
meiner lieben Frau unternehme, laßen uns täglich schon die Umgebung Nauheims mehr schätzen lernen. - Im Winter war ich mit meiner Arbeit beschäftigt, die, so meine Hoffnung in Erfüllung geht,
eine sorgfältige Bearbeitung der Morbilitäts- u[nd] Mortalitäts-Statistik Deutschlands anbahnen soll. Die Schrift [Beneke, 1857] wird Ihnen dort vorgelegt sein oder vorgelegt werden. –
Von Vogel höre höre ich zu meinem tiefen Betrübnis noch immer nichts Erfreuliches. Bin ich recht unterrichtet, so liest er in diesem Sommer selbst gar kein Colleg - eine übrigens unverbürgte Nachricht. Könnte man dem lieben Freunde u[nd] tüchtigen Manne doch helfen! - Ich fürchte, der Kampf dort wird seine Kräfte aufreiben! -
In Giessen findet augenblicklich eine Untersuchung gegen Brück statt, deßen Entfernung als ein nicht unwahrscheinliches Ereignis bezeichnet wird. Leider überall Streit und Fehde! - Und die Wißenschaft sollte doch ein so enges Band um Alles schlingen, die ihr angehören, ohne damit die wißenschaftliche Kritik hintenanzusetzen? -
Haben Sie die Güte, mich einmal durch einige Zeilen zu erfreuen, so erfahre ich hoffentlich auch, wie es Ihnen und den geschätzten Ihrigen geht. Um eine herzliche Empfehlung an Ihre Frau
Gemahlin bitte ich. - Mit treuer Anhänglichkeit bleibe ich aber stets
Ihr aufrichtig ergebener Schüler
F. W. Beneke“
Balneologie vom Mittelalter bis zu Friedrich Wilhelm Beneke
Das Bad im Mittelalter an einer bestimmten Quelle oder in einer Badestube an bestimmten Tagen des Jahres war eine Handlung, die sowohl im heidnischen wie im christlichen Glauben ihre Begründung hatte. Krankheiten, die vielleicht auch infolge des Badens auftraten, wurden als götter- bzw. gottgewollte Strafen angesehen. In einer Quelle baden war die Hoffnung vieler Kranken. Häufig wird in der Geschichte von „Aussätzigen“ gesprochen, die auf ein „Wunder Gottes“ hofften und fortan geheilt waren (Martin, 1906).
Im christlichen Glauben bezog sich das Abwaschen nicht allein auf die äußeren Verunreinigungen, sondern auch auf das „Abwaschen“ der Sünden. Es galt als Buße, wenn ein Mensch andere (Arme, Kranke, Pilger) wusch. Es gab Bürger, die bestimmten, daß nach ihrem Tod das Erbe für „Seelenbäder“ verwendet wurde, in dem einmal im Jahr viele Arme ein Bad erhielten, und diese während des Bades des Verstorbenen gedachten. Das Bad am 24. Juni, St. Johannis (Baptistae), zur Bewahrung vor und Heilung von Krankheiten ist als Überlieferung eines heidnischen Brauchs anzusehen.
Die Urteilsfindung, ob jemand eines Verbrechens schuldig oder man es z. B. mit einer Hexe zu tun hatte, wurde u. a. mittels der Anwendung des „Bades“ (Wasserurteil bzw. Wasserprobe) entschieden. Dabei wurde der oder die mit einem Strick gefesselten Angeklagte ins Wasser geworfen. Ging der Körper im Wasser unter, galt das als Beweis der Unschuld, war dies nicht der Fall, war der Mensch schuldig, da das Wasser den Körper abstieß. Zu anderen Zeiten gab es auch umgekehrte Auslegungen des Urteils. Das Urteil wurde von der Gottheit gefällt. Zeitweise wurden auch Teufelsaustreibungen mittels Wasseranwendungen praktiziert (Martin, 1906, Schmitter, 1986).
Das Bad hatte auch gesellschaftliche Bedeutung. So war z. B. das gemeinschaftliche und oft lange andauernde Bad von Brautleuten und den Hochzeitsgästen ein wichtiges Hochzeitszeremoniell, das wohl auch unter dem Aspekt der geistigen Reinigung zu sehen ist. Schon im Mittelalter gab es Zeiten, in denen das häufige gemeinschaftliche Bad von Bürgern eines Ortes als gesellschaftliches Vergnügen und zum Austausch von interessanten Neuigkeiten diente. Die in der Neuzeit mehr und mehr entstehenden Kurorte wechselten auch ihre Bedeutung. Waren es erst nur Ortsansässige, die die Heilquellen und Badeeinrichtungen nutzten, kamen bald von weit her Gereiste, die diese Einrichtungen benutzten, um gesund zu werden. War der Ort erst als Heilbad bekannt, gewann er nicht selten Bedeutung durch ein großes Angebot von Vergnügungsmöglichkeiten.
In den Kurorten war zunächst nicht selbstverständlich, daß ein Arzt zur Verfügung stand. Erst im 16. Jahrhundert kamen nach und nach Ärzte in die Kurorte, meistens fahrende Ärzte, die nur
vorübergehend dort tätig waren, oder Ärzte, die eine wohlhabende Persönlichkeit begleiteten und betreuten (Martin, 1906; Schmitter, 1986).
Im 16. Jahrhundert entstand die erste Badeliteratur im deutschsprachigen Raum, in der schon erste Zusammenhänge zur Medizin im Sinne der allgemeinen, zeitentsprechenden Heilkunde. Es wurden Baderegeln zur richtigen Anwendung von Bädern bei verschiedenen Krankheiten niedergeschrieben. Dabei handelte es sich meist um ärztliche Hinweise, aber nicht um ärztliche Anordnungen. Johann Heinrich von Cranz (25.11.1722 Roodt (Luxemburg) - 19.01.1797 Judenbug (Steiermark)), Mediziner und Geburtshelfer, schrieb 1777 das Buch „Die Gesundbrunnen der österreichischen Monarchie“. Cranz förderte auch die Ausbildung geeigneter Fachkräfte für die Bäderkunde, was danach zum Wissenschaftszweig der Balneologie führte. Er führte 1754 in Wien den Unterricht in Geburtshilfe ein. Bis ins 19. Jahrhundert war üblich, möglichst lange im Bad zu verweilen, manchmal Stunden. Erst wenn sich Hautausschlag zeigte, sollte die Badezeit eingeschränkt werden.
Zu den Badekuren kamen die Trinkkuren. Das Trinken von verschiedenen Quellwässern wurde als der Gesundheit zuträglich erkannt. Der Patient sollte möglichst viel, oft mehrere Liter, trinken was zunächst zu Unwohlsein, Magendrücken und Diarrhö führen konnte und als „Brunnenkrise“ bzw. „Brunnenreaktion“ angesehen wurde. Insgesamt wurden Bade- und Trinkkuren willkürlich angewandt, ohne daß eine systematische, auf individuelle Beobachtungen und Untersuchungen gestützte Grundlage vorhanden war (Martin, 1906; Schmitter, 1986).
Christoph Wilhelm von Hufeland (12.08.1762 Bad Langensalza - 25.08.1836 Berlin), einer der berühmtesten Ärzte seiner Zeit, wirkte tatkräftig auf dem Gebiet der Seuchenbekämpfung und Sozialhygenie. Er war unter anderem an der Einführung der Kuhpockenschutzimpfung in Deutschland mitbeteiligt. Große Bedeutung maß er auch der Balneologie bei und arbeitete eingehend an der Aufgabe, die Anwendungen von Bade- und Trinkkuren nicht willkürlich, sondern nach kritischer Abwägung möglicher Wirkungen auf den menschlichen Organismus individuell in einen Therapieplan umzusetzen. Eine wesentliche Aufgabe der Balneologie war nach Hufeland, die genaue Beobachtung der Wirkung der Bade- und Trinkkuren auf den gesunden und kranken Organismus. Auch die Beurteilung der chemisch-physikalischen Beschaffenheit einer Quelle und deren Wirkung auf das Individuum gehörte zu Hufelands Untersuchungen (Michler, 1970).
Christoph W. Hufelands Bestrebungen waren zunächst stark praxisorientiert. Er wollte sehr genau und wohlüberlegt die balneologischen Behandlungsmittel als Teil einer umfassenden Therapie (in Form
kombinierter Bade-, Trinkkuren und Diät) gegen verschiedene Krankheiten einsetzen. Dazu benötigte er die chemisch-physikalische Analyse einer Quelle, soweit dies zur damaligen Zeit möglich war.
Die unmittelbare Beobachtung von gesunden und kranken Menschen und ihren individuellen Bedürfnissen sowie die Beobachtung der Wirkung des Quellwassers auf den Patienten führte zu einer
rationellen Empirie (Michler, 1970, Schmitter, 1986).
Um den Nutzen seiner Erkenntnisse möglichst vielen Ärzten zugänglich zu machen, mußte Hufeland die einzelnen Informationen systematisch ordnen. Die Aufstellung einer von alten Systemen
unabhängigen Systematik dieser vielen praktischen Erkenntnisse über balneologische Anwendungen setzte eine theoretische Begründung für die verschiedenen Wirkungen der Bade- und Trinkkuren auf den
menschlichen Organismus voraus. Er entwarf eine Theorie, die insofern spekulativ war, da sie auf eine zu Hufelands Zeiten bedeutende philosophische Richtung - den Vitalismus - begründet war.
Danach enthielt das organische Leben eine „vis vitalis“ (Lebenskraft) und - nach Hufeland - die Heilquellen ein „pabulum vitae“ (Lebensnahrung), innere Kräfte, die der menschlichen Erfassung
durch Forschung - wie zum Beispiel chemisch-physikalische Analysen - nicht zugänglich waren, da sie einer geistigen Ebene zugeordnet wurden.
Mit der Aufstellung eines Konzeptes, einer theoretischen systematischen Grundlage, in Form von Badeschriften für die sinnvolle Anwendung von Bädern und Trinkkuren sowie der deutlich dargestellten
Beobachtungen und chemisch-physikalischen Analysen kann man das Wirken von Christoph Wilhelm Hufeland bereits als wissenschaftlich (nicht als naturwissenschaftlich) bezeichnen (Michler, 1970,
Schmitter, 1986).
Nauheim (ab 1869 Bad Nauheim)
Nauheim, ab 1869 Bad Nauheim, liegt an den Ausläufern des Taunus in der Wetterau. Bereits 500 und 100 v. Chr. legten die Kelten entlang der Usa eine der größten späteisenzeitlichen Siedlungen an,
die der Salzgewinnung dienten. Sie errichteten zwei große Salzsiedeanlagen, wobei die Sole zunächst in großen Becken vorgradiert, danach in Tontöpfe gefüllt und anschließend in Öfen gekocht
wurde, um einen festen Salzkuchen zu erhalten. Die Siedeanlagen wurden im ersten Jahrhundert vor Chr. aufgegeben.
Um 700 n. Chr. nahmen fränkische Siedler die Salzgewinnung wieder auf. Aus dieser fränkischen Siedlung entstand ein mittelalterliches Söderdorf, das im Jahre 900 in einem Zinsregister des Klosters Seligenstadt unter dem Namen „Niwiheim" erstmals urkundlich erwähnt wurde.
Bad Nauheim (Parkstraße um 1910)
Während des Mittelalters wurden die Salzsiedereien von Södern betrieben, die sich in einer Zunft zusammengeschlossen hatten. Bereits 1489 besaß das Dörfchen Nauheim 13 Soden. Im 16. Jahrhundert
brachten die steigenden Brennholzpreise die Söderfamilien in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Der Hanauer Landesherr brachte die Siedeanlagen 1585 in seinen Besitz und ließ die Salzgewinnung
modernisieren.
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts führte der Leiter des Salzwerkes, Joseph Todesco, die Schwarzdorngradierung ein. Vorher hatte man Strohgeflechte benutzt. Bad Nauheim gehört zu den ersten
mitteleuropäischen Salinen, die über diese Gradiermethode verfügten. Die Gewinne aus der Salzproduktion stiegen beträchtlich.
Im Jahre 1733 fiel Nauheim an die Landgrafen von Hessen-Kassel. Der General-Salinendirektor Jakob Sigismund Waitz von Eschen baute die Nauheimer Saline mit einem Kostenaufwand von 800 000 Gulden
zu einer der größten Salinen Deutschlands aus. Er verbesserte die Wasserkraftanlagen und errichtete zwei Windmühlen, deren Türme noch heute erhalten sind. Einer der beiden, heute „Waitzscher
Turm" genannt, befindet sich im Kurpark nahe der Usa.
Ein Gradierbau bestand aus einem neun bis elf Meter hohem Balkengerüst, das mit Schwarzdornreisern aufgefüllt wurde. Die Sole wurde mittels Windmühlen und Wasserrädern bis oben auf die
Gradierbauten gepumpt und rieselte durch die Schwarzdornreiser, an denen die Wasserverdunstung stark beschleunigt wurde. Sammelbehälter am Fuße der Gradierbauten fingen das bereits
höherprozentige Salzwasser auf, welches nochmals über die nächsten Gradierbauten geleitet wurde. Die Sole in Nauheim hatte eine Konzentration von ca. 3 % Kochsalz und wurde durch die Gradierung
auf 15 bis 22 % Kochsalz erhöht, bevor sie in einem der Siedehäuser versotten wurde.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts verschickten die Nauheimer Sole zur Behandlung Kranker nach Wilhelmsbad und Hanau. Im benachbarten Friedberg nutzen bereits zwei Ärzte die heilende Wirkung des
salzigen Wassers. Den Södern erlaubte man 1823 die Einrichtung eines „Knappschaftsbades“, das lediglich aus einer Wanne bestand, der „Ersten Sool-Badeanstalt zu Nauheim“. Schnell entdeckte man
die heilende Wirkung der Sole, und 1835 wurde das erste Badehaus mit 9 Wannen und einem Wohnhaus mit neun Gästezimmern auf dem Gelände der heutigen Dankeskirche errichtet.
In den mineralreichen heißen Quellwässern (37 °C bis 70 °C) von Aachen badeten bereits in 1. Jahrhundert n. Chr. die Soldaten der römischen Cäsaren zur Heilung und Gesunderhaltung. Dagegen ist Nauheim im Unterschied zu den alten, traditionsreichen Badeorten wie Aachen, Karlsbad oder Baden-Baden, die bereits auf die Römer zurückgehen, eine Gründung des 19. Jahrhunderts. Dr. Friedrich Bode (1811 - 1899) ließ sich 1837 als Arzt nieder, der dann zum amtlichen Badearzt ernannt wurde und der Vorgänger von Friedrich Wilhelm Beneke war. Bode machte 1845 mit einer Schrift auf die warmen Solquellen aufmerksam (Bode, 1845). Der Chemiker Robert Wilhelm Bunsen (31.03.1811 Göttingen - 16.08.1899 Heidelberg) berichtete bereits 1837 und 1841 über die Nauheimer Thermalquellen (Bunsen, 1837,1841).

Gradierwerk
Man begann mit Quellenbohrungen, doch schienen diese keine Ergebnisse zu bringen. In der stürmischen Nacht vom 21. auf 22. Dezember 1846 durchbrach ein mächtiger Solstrom die Erde aus einem aufgegebenen Bohrloch und trat schäumend und dampfend zutage. Dies war die Geburt des Großen Sprudels ("Nauheimer Weihnachtswunder"). Als der Große Sprudel 1855 für sechs Wochen versiegte, hielt man die erste Quellendankfeier ab. Im Mai entsprang die Friedrich-Wilhelm-Quelle im Sprudelhof. Auf der Sprudelfassung liest man heute:
„AUF GOTTES GEHEISS AUS DER TIEFE GEBOREN
DER LEBENDEN LEIDEN ZU LINDERN ERKOREN"
Im Jahre 1854 erhielt Nauheim das Stadtrecht. Es etablierte sich eine Spielbank, die Stadt finanzierte den Bau des Kurhauses und die Anlagen des Kurparks. 1869 durfte sich die Stadt Bad Nauheim
nennen. Die Spielbank schloß bereits im Jahr 1872.
Mit Dr. Friedrich Wilhelm Beneke (ab 1857) als ersten Brunnenarzt Nauheims begann die Blütezeit als Herzheilbad. F. W. Beneke veröffentlichte die erste Schriften über die Behandlung Herzkranker mit kohlensäurehaltigen Solbädern (Beneke, 1859, 1860 a, b; 1861). In der ersten Schrift „Über Nauheims Soolthermen und deren Wirkungen auf den gesunden und kranken menschlichen Organismus“, liest man, daß das Wasser durch den vorwiegenden Anteil an Natrium (Na+)- und Chlor (Cl-)- Ionen als kochsalzhaltiges Wasser verstanden werden muß. Der Mineralstoffgehalt überstieg dabei 1.4 %, das heißt, daß ein Liter der Nauheimer Solquelle mehr als 14 g gelöste Bestandteile enthielt. Dazu kamen noch zusätzliche Eigenschaften, da einige der Quellen auch besonders warm und kohlensäurehaltig waren. Dabei lag der Gehalt an freier gelöster Kohlensäure bei ungefähr 1250 mg pro Kilogramm Wasser. Je nach Temperatur und Zusammensetzung unterschied man zwischen Kohlensäure-Kochsalz-Thermen (ca. 1250 mg gelöste Kohlensäure im Liter Wasser; 2.6 bis 3.3 % Mineralstoffgehalt; 30 bis 33° C Wärme) und Thermal-Kohlensäure-Sole-Quellen (ca. 1250 mg gelöste Kohlensäure im Liter Wasser; ca. 1 % Mineralstoffgehalt; 30 bis 33° C Wärme). Dazu gesellten sich noch Quellen, welche die Zusatzbezeichnung „eisenhaltig“ erhielten. Diese mußten mindestens 10 mg Eisen pro Kilogramm Wasser enthalten.

Sprudelhof
Dank der Heilerfolge von F. W. Beneke stieg Bad Nauheim zum Weltbad für Herz- und Kreislauferkrankungen auf. Unter den Gästen findet man u. a. die Kaiserinnen Elisabeth von Österreich (Sisi)
(1898), Alexandra von Rußland (1912) und Auguste Viktoria von Deutschland (1912).
Die Salzproduktion ging in den folgenden Jahren aufgrund des billigeren Steinsalzes immer mehr zurück, bis 1959 die Saline endgültig geschlossen wurde. Die zum Teil heute noch erhaltenen
Gradierbauten dienen der Freiluftinhalation. Die Sole wird bis heute zu Heilzwecken angewandt. Die Luft in der Nähe der Gradierbauten enthält salzhaltige Wassertröpfchen in hoher Konzentration,
die mit der Nordseeluft vergleichbar sind.
Auch in Nauheim kam die soziale Komponente von Friedrich Wilhelm Beneke zum Vorschein, indem er dafür sorgte, daß 1860 mit bescheidenen Mitteln ein Kurheim für sozial schwache, also arme,
minderbemittelte Kurgäste eingerichtet wurde (Beneke, 1860-1867). Weiterhin beschäftigte er sich mit der Balneologie und Balneotherapie (Beneke 1860 c), zu denen einige Schriften entstanden. In
diesen Publikationen spricht er über die Wirkungen der Nauheimer Solquelle gegen Rheumatismus (Beneke, 1863), den Nauheimer Solthermen gegen Gelenkrheumatismus mit und ohne Herzaffektion (Beneke,
1870 b) und den gegenwärtigen Stand der Balneologie (Beneke, 1865).
Besonders ist zu berücksichtigen, daß sein Wirken als Pathologe eine große Rolle spielte bei seinem Versuch, eine wissenschaftliche Grundlage für die Balneologie zu erarbeiten. Er ging bei seinen Überlegungen zu Krankheitsursachen und zur Therapie nicht ausschließlich von morphologischen Veränderungen des Organs aus, sondern beschäftigte sich auch mit der Frage, welche krankmachenden Prozesse, d. h. welch funktionellen Veränderungen verschiedenen Leiden zugrunde liegen. Dabei stellte für ihn die Stoffwechselpathologie ein besonderes Interessengebiet dar. Die Erkenntnisse als Badearzt waren dabei von großem Wert. Seine Studien über den Stoffwechsel beeinflussten wiederum Behandlungspläne seiner Nauheimer Patienten.
F. W. Beneke hatte prominente Patienten, so auch 1859 Otto Fürst von Bismack (01.04.1815 Schönhausen an der Elbe - 30.07.1898 Friedrichsruh bei Hamburg). Dieser wurde wegen Beschwerden im linken
Bein, die sich nach einem Unfall aus dem Jahre 1857 neben rheumatischen Beschwerden immer wieder einstellten, behandelt.
Bismarck schrieb dazu in seinen Gedanken und Erinnerungen:
" Neuling in dem Klima von Petersburg, ging ich im Juni 1859 nach anhaltenden Reiten in einer überheizten Reitbahn ohne Pelz nach Hause, hielt mich auch noch unterwegs auf, um exercirenden
Rekruten zuzusehen. Am folgenden Tage hatte ich Rheumatismus in allen Gliedern, mit dem ich längere zu kämpfen hatte. Als die Zeit herankam abzureisen, um meine Frau[1] nach Petersburg zu holen,
war ich übrigens wieder hergestellt, nur daß sich in dem linken Beine, das ich auf dem Jagdausflug nach Schweden im Jahre 1857 durch einen Sturz vom Felsen beschädigt hatte, und das infolge
unvorsichtiger Behandlung der locus minoris resistentiae geworden war, ein geringfügiger Schmerz fühlbar machte. Der durch die frühere Großherzogin von Baden mir bei der Abreise empfohlne Dr.
Walz erbot sich, mir ein Mittel dagegen zu verschreiben, und begegnete meiner Erklärung, ich fühle kein Bedürfniß etwas anzuwenden, da der Schmerz gering sei, mit der Versicherung, die Sache
könne auf der Reise schlimmer werden und es sei rathsam, vorzubeugen. Das Mittel sei ein ganz leichtes; er werde mir ein Pflaster in die Kniekehle legen, welches in keiner Weise belästige,
nach
einigen Tagen von selbst abfallen und nur eine Röthe hinterlassen werde. Mit der Vorgeschichte dieses aus Heidelberg stammenden Arztes noch unbekannt, gab ich leider seinem Zureden nach. Vier
Stunden, nachdem ich das Pflaster aufgelegt und fest geschlafen hatte, wachte ich über heftige Schmerzen auf, riß das Pflaster ab. Ohne seine Bestandtheile von der schon wund gefressenen
Kniekehle entfernen zu können. Walz kam einige Stunden später und versuchte mit irgend einer metallischen Klinge die schwarze Pflastermasse aus der handgroßen Wunde durch Schaben zu entfernen.
Der Schmerz war unerträglich und der Erfolg unvollkommen, die corrosive Wirkung des Giftes dauerte fort. Ich wurde mir über die Unwissenheit und Gewissenlosigkeit meines Arztes klar trotz der
hohen Empfehlung, die mich bestimmt hatte ihn zu wählen. Er selbst versicherte mit entschuldigendem Lächeln, die Salbe sei wohl etwas zu stark gepfeffert worden; es sei ein Versehn des
Apothekers. Ich ließ von dem Letztern das Recept erbitten und erhielt die Antwort, Walz habe es wieder an sich genommen; Letztrer besaß es nach seiner Aussage nicht mehr. Ich konnte also nicht
ermitteln, wer der Giftmischer gewesen war, und erfuhr nur von dem Apotheker, der Hauptbestandtheil der Salbe sei der Stoff gewesen, der zur Herstellung von sogenannten immerwährenden spanischen
Fliegen verwendet werde, und nach seiner Erinnerung sei derselbe allerdings in einer ungewöhnlich starken Dosis verschrieben gewesen. Es ist mir später die Frage gestellt worden, ob meine
Vergiftung eine absichtliche gewesen sein könne; ich schreibe sie lediglich der Unwissenheit und Dreistigkeit des ärztlichen Schwindler zu.
Er war mir auf Grund einer Empfehlung der verwitweten Großherzogin Sophie von Baden[1] Dirigent sämmtlicher Kinderhospitäler in Petersburg geworden. Meine späteren Ermittlungen ergaben, daß er der Sohn des Universitätconditors in Heidelberg war, als Student nicht gearbeitet und keine Prüfung bestanden hatte. Seine Salbe hatte eine Vene zerstört, und ich habe viele Jahre lang schwer daran gelitten.
Um bei deutschen Aerzten Hülfe zu suchen, reiste ich im Juli auf dem Seewege über Stettin nach Berlin; heftige Schmerzen veranlaßten mich, dem berühmten Chirurgen Pirogow [Nikolai Iwanowitsch Pirogow (25.11.1810 Moskau - 05.12.1881 Gut Wischnja)], der mit an Bord war, zu fragen. Er wollte mir das Bein amputiren, und auf meine Frage, ob über oder unter dem Kniee, bezeichnete er eine Stelle hoch darüber. Ich lehnte ab und wurde, nachdem in Berlin verschiedne Behandlungen erfolglos versucht waren, durch die Bäder von Nauheim unter Leitung des Professors Benecke (sic) aus Marburg so weit wiederhergestellt, daß ich gehen, auch reiten und im October den Prinzregenten nach Warschau zur Zusammenkunft mit dem Zaren begleiten konnte. Während ich auf der Rückreise nach Peterburg Herrn von Below in Hohendorf im November einen Besuch machte, riß sich nach ärztlicher Meinung der Trombus los, der sich in der zerstörten Vene gebildet und festgesetzt hatte, gerieth in den Blutumlauf und verursachte eine Lungenentzündung, die von den Aerzten für tödlich gehalten, aber in einem Monate langen Siechthum überwunden wurde. Merkwürdig sind mir heut die Eindrücke, die damals ein sterbender Preuße über Vormundschaft hatte. Mein erstes Bedürfnis nach meiner ärztlichen Verurtheilung war die Niederschrift einer letztwilligen Verfügung, durch welche jede gerichtliche Einmischung in die eingesetzte Vormundschaft ausgeschlossen wurde. Hierüber beruhigt sah ich meinem Ende mit der Bereitwilligkeit entgegen, die unerträgliche Schmerzen gewähren. In Anfang des März 1860 war ich so weit, nach Berlin reisen zu können, wo ich, meine Genesung abwartend, an den Sitzungen des Herrenhauses Theil nahm und bis in den Mai verweilte“ (Bismarck, 1898).
-----------------------
[3] Johanna von Bismarck, geb. von Puttkammer (11.04.1824 Viartlum (Provinz Pommern) - 27.11.1894 Varzin (Provinz Pommern)
[4] Sophie von Baden, geb. Prinzessin von Schweden (21.05.1801 Stockholm - 06.07.1865 Karlsruhe)
---------------------
Marburg
Die Berufung für Friedrich Wilhelm Beneke nach Marburg hatte das Problem, daß er nur im Wintersemester lesen konnte, da er gleichzeitig als 1. Badearzt in Nauheim tätig war. Daran scheiterte auch
die ursprünglich erwogene Berufung als Ordinarius für innere Medizin. Es fand sich der Ausweg ihm das offiziell noch nicht vertretende Fach der pathologischen Anatomie zu übertragen. Im
Wintersemester 1858/59 wurde der Lehrauftrag für pathologische Anatomie an der Universität Marburg an der Lahn für Friedrich Wilhelm Beneke erweitert, indem er mit der Direktion des vorerst
versuchsweisen errichteten Pathologischen Instituts betraut wurde. Gleichzeitig erhielt er den Titel des Geheimen Medizinalrates. Sektionen waren sehr selten; die chirurgischen wurden in der
chirurgischen Klinik vorgenommen, und die Kämpfe zwischen Kliniker und Pathologen betreffs des Materials blieben nicht aus. Von den insgesamt 28 Studenten der Medizin in Marburg hörten 6 bis 8 in
den nächsten Jahren die angekündigten Wintervorlesungen über pathologische Anatomie. Praktische Übungen waren untunlich, die pathologische Anatomie spielte als Examensfach keine Rolle.

Marburg (alter Stich)
Im Jahre 1863 wurde F. W. Beneke zum außerordentlichen Professor, 1867 zum ordentlichen Professor der pathologischen Anatomie ernannt. Vorher hatte er 1866 seine glänzende Stellung in Nauheim aus
Liebe zum akademischen Beruf teilweise aufgegeben. Durch nicht nachvollziehbare Umstände erfolgte die Verschiebung für seine weitere Lebensarbeit, in dem ihm die vom Minister Heinrich von Mühler
(04.11.1813 Brieg - 02.04.1874 Potsdam) versprochene Leitung der medizinischen Klinik in Marburg, welches er eigentlich anstrebte, tags darauf von Friedrich Theodor von Frerichs Assistent Emil
Mannkopff (1836 - 1918) übernommen wurde und F. W. Beneke sich von der praktischen Medizin auf ein anderes Fach umstellen mußte. Somit hielt er an der Universität Marburg ein selbständiges
Ordinariat für pathologische Anatomie und allgemeine Pathologie. Das Pathologische Institut war damit eine endgültige Einrichtung der Universität Marburg geworden, dessen Direktor F. W. Beneke
blieb. In den Jahren 1875 und 1880 bekleidete er zusätzlich das Amt des Dekans der medizinischen Fakultät.
Seine Doppelstellung als Badearzt und Hochschullehrer hielt F. W. Beneke bis zu seinem Lebensende bei. Ab 1866 wirkte er nicht mehr als Erster Brunnenarzt in Nauheim, sondern als balneologisch
tätiger Arzt mit einer Privatpraxis, welches politische Gründe hatte.
Das Kurfürstentum Hessen mit der Stadt Marburg wurde 1866 dem Königreich Preußen eingegliedert, während das Großherzogtum Hessen mit Nauheim selbständig blieb. Das Heimatland von F. W. Beneke Hannover war seit 1814 Königreich (vorher Kurfürstentum) und Mitglied des 1815 gegründeten Deutschen Bundes. Von 1714 bis 1837 stand Hannover in Personalunion mit Großbritannien. Im Jahre 1866, nach Auflösung des Deutschen Bundes, wurde Hannover neben Schleswig-Holstein, Frankfurt am Main, Nassau und Kurhessen (mit der Stadt Marburg) im Königreich Preußen eingegliedert. Da Hannover nun preußisch wurde, entschied sich F. W. Beneke für die preußische Staatsangehörigkeit. Er blieb Professor der Pathologie in Marburg und erhielt sowohl von der Großherzoglich-hessischen und von der preußischen Regierung die Genehmigung, seine badeärztliche Tätigkeit in Nauheim (das nicht zu Preußen gehörte) als Privatarzt fortzusetzen. Diese Tätigkeit übte er im Sommer an drei Tagen pro Woche aus.
F. W. Beneke wurde ab 1858 zusätzlich Fürstlich-Waldeckischer Leibarzt („consultierender Arzt des Fürsten von Waldeck“). Das Fürstentum Waldeck (seit 1712 Reichsfürstentum), am Nordostrand des Rheinischen Schiefergebirges gelegen, grenzte im Norden und Westen an das Königreich Preußen, im Süden und Osten reichte es bis 1866 an das Kurfürstentum Hessen. Nachdem 1866 das Kurfürstentum Hessen dem Königreich Preußen eingegliedert worden war, war Waldeck ganz vom Preußischen Reich umgeben. Waldeck wurde Mitglied des 1866 bis 1867 gegründeten Norddeutschen Bundes (Beneke R., 1929, Beneke R., 1935; Schmitter, 1986).
Die Universität Marburg wurde 1527 durch den 23jährigen hessischen Landgrafen Philipp den Großmütigen (13.11.1504 Marburg - 31.03.1567 Kassel) als zweite protestantische Hochschule nach Einführung der Reformation gegründet (die älteste protestantische Universität bestand von 1526 bis 1530 im schlesischen Liegnitz). Die Universität Marburg behielt ihren konfessionellen Charakter bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Bei der Gründung waren vier Fakultäten vorgesehen: Artistik (Philosophie), Theologie, Jura und Medizin. Am 1. Juli 1527 begann mit elf Professoren und 84 Studenten in den bisherigen Klostergebäuden der Stadt das „universale studium Marburgense“, das dem „christlichen Nutzen und der gemeinen Landschaft zum Besten gelehrte, geschickte und gottesfürchtige Leute, Prediger und Amtleute“ heranbilden sollte. Zunächst standen für die Mediziner ein, ab 1542 zwei und ab 1564 drei Ordinariate zur Verfügung. Landgraf Moritz der Gelehrte (25.05.1572 Kassel - 15.03.1632 Eschwege) berief 1609 Johannes Hartmann (15.01.1568 Amberg - 17.12.1631 Kassel), der schon von 1592 bis 1609 Professor der Mathematik in Marburg war, zum Professor für medizinische und pharmazeutische Chemie (Chymiatrie). Dies war die erste Professur für Chemie in Europa, die nicht mehr der Alchemie, sondern dem der Heilkunde verpflichtenden Teil der Chemie gewidmet war. Hartmann gründete das erste chemische Universitätslaboratorium in Deutschland. In einem Labortagebuch aus dem Jahre 1615 wird aufgezeigt, daß Hartmann die Zubereitung opiumhaltiger Präparate z. B. Laudanum opiatum seinen Studenten lehrte. Die Studentenzahl der Universität Marburg schwankte in den ersten drei Jahrhunderten zwischen 30 bis 300. Der große Aufschwung für Marburg und die Universität kam 1866, als Hessen von Preußen annektiert wurde (Schmitz und Winkelmann, 1966).
In Marburg kam Friedrich Wilhelm Beneke ab 1858 seinem Lebensziel näher, indem in seinem pathologischen Institut Sektionsmesser, Mikroskop und Reagenzglas gleichberechtigt eingesetzt wurden. Sein
Ziel war, eine umfassende klinische Pathologie auf chemischer Forschung aufzubauen, um die krankhaften Vorgänge durch die Zellchemie zu entwirren. Pathologisch anatomische Formveränderungen
galten für ihn in erster Linie als Ausdruck chemischer Umlagerungen. Im Jahre 1861 gelang ihm die Entdeckung des allgemein verbreiteten Vorkommens des Cholesterins in der Pflanzenwelt, und
dessen Reindarstellung (Beneke, 1862 a). Mit dieser chemischen Verbindung und deren Beziehungen zu den Myelinen widmete sich F. W. Beneke mit der größten Aufmerksamkeit. Myelin, griech.:
Nervenmark: Lipide und Proteine der Lamellenwicklung in den Gliazellen, die die Markscheide markreicher Nervenfasern bilden. Myelin ist eine doppelbrechende Substanz, bestehend aus verschiedenen
Lipiden und Eiweißen, die innerhalb der Markscheide (Myelinscheide) der Nervenfasern eine bestimmte geordnete Verteilung aufweist. Er erkannte die außerordentliche Bedeutung der Myelinen für alle
zellulären Formgestaltungen und sah in diesen die Träger der wichtigsten Stoffwechselprozesse (Fettresorption usw.). Die Myelinen betrachtete er als Vermittler alles Zellenlebens, somit auch
bestimmter Vergiftungen (Chloroform u. a.) (Beneke, 1862 b).
Eine große Fülle zu jener Zeit wenig verstandener Einzelarbeiten wurden von F. W. Beneke publiziert. Diese dienten als Unterlage klarer Vorstellungen, welche heute in der Lipidforschung sowie für die Bedeutung der Kolloid- und Grenzflächenforschung und der Biochemie Bestätigung und Ausbau gefunden haben (Beneke, 1866 a, b).
Der mikroskopischen Technik hat F. W. Beneke relativ wenig Aufmerksamkeit geschenkt, obwohl er viel mikroskopierte. Er arbeitete nach alten einfachen Methoden, mit einer gewissen Vorliebe für die
Beobachtung mikrochemischer Prozesse. Dazu gehörte die Kristallbildung unter dem Deckgläschen oder die Pettenkofersche Reaktion[5] des Cholesterinnachweises durch Zucker und Schwefelsäure
(Rotfärbung), die er eingehend schilderte (Beneke, 1862a). Es ist von histologischem Interesse, daß F. W. Beneke 1860 in der ersten histologischen Arbeit „Über die Nichtidentität von Knorpel-,
Knochen- und Bindegewebe“, erstmals beschrieb, daß es ihm gelungen sei, die Gewebe und namentlich die Zellkerne durch Zusatz von Karmintinte deutlich zu machen und diesen Kunstgriff den
Histologen empfahl (Beneke, 1860 d). Etwas später schrieb er, daß sich für solche Zwecke besonders Anilinfarben (Anilinessigsäure) eigneten (Beneke R., 1935).
Einen Einblick in das Gesamtwissen der pathologisch-klinischen Chemie brachte F. W. Beneke 1874 mit seinem Hauptwerk auf diesen Gebiet „Grundlinien der Pathologie des Stoffwechsels“ heraus (Beneke, 1874). In diesem Werk schrieb er u. a.:
„..., dass eine wissenschaftliche Pathologie nicht eine humoralpathologische, nicht eine neuropathologische, nicht eine solidarpathologische sein, nicht von einem Ausgangspunkt aus aufgerichtet werden kann, dass sie vielmehr nur mit der umsichtigsten Erforschung und Feststellung der Störungen sämtlicher bei der Ernährung concurrirender Verhältnisse, des Bildungsmaterials sowohl, als des functionirenden anatomischen Apparates, ihren Namen verdient. Mit den älteren Vorstellungen der Mischungsalterationen des Blutes und der vasomotorischen Störungen kommen wir nicht mehr aus. Die Aufnahme der Vorstellung einer activen Betheiligung der Zellen an dem Ernährungsproblem im normalen und pathologischen Zustande wird zur Nothwendigkeit, und der Fortschritt, welchen diese Vorstellung in der ganzen Ernährungslage bedingt, wird umso klarer werden, je mehr wir in der Erkenntnis der Eigenschaften und der chemischen Bestandtheile der protoplasmatischen Substanzen voranschreiten“.
-------------
[5] Max Josef von Pettenkofer (03.12.1818 Lichtenheim (Einöde bei Neuburg an der Donau) - 10.02.1901 München; Freitod). Hygieniker und Chemiker. Auf seine Anregung wurde in München das erste Hygienische Institut in Deutschland (1879) gegründet.
------------

Marburg (Universität und Schloss um 1910)
Damit stellte der Pathologe Friedrich Wilhelm Beneke die Erforschung des Zellbildungsprozesses und die physikalisch-chemischen Veränderungen in der Zelle bei verschiedenen Krankheiten, mit der
Ausdehnung auf physiologisch-chemische Fragen, in den Mittelpunkt seiner Arbeiten. Wie außergewöhnlich diese Denkansätze und die Vorgehensweise F. W. Benekes zu seiner Zeit waren, merkt man
daran, daß sich die Marburger Medizinstudenten im Jahre 1862 über ihren Dozenten Beneke beklagten, weil er im Rahmen der Pathologie dauernd über „Zellen“ sprach.
Zwischen der Zellularpathologie Rudolf Virchows (13.10.1821 Schivelbein (Pommern) - 05.09.1902 Berlin) und F. W. Beneke bestand der wesentliche Unterschied in der Auffassung der Zellneubildung.
Virchow hatte bereits 1855 und später in seinem Werk „Cellularpathologie“ (Virchow, 1858) geschrieben, daß sich eine Zelle nur aus einer Zelle neubilden kann, wobei er den heute noch gültigen
Satz schrieb „Omnis cellula e cellula - Jede Zelle entstammt einer Zelle“. Spitz formulierend schrieb Virchow: „Der Körper ist ein Zellenstaat, in der jede Zelle einen Bürger darstellt. Krankheit
ist lediglich ein Konflikt der Bürger dieses Staates, den die Einwirkungen äußerer Kräfte herbeiführt."
F. W. Beneke ging von der Richtigkeit der Zelltheorie des Botanikers Matthias Jacob Schleiden (05.04.1804 Hamburg - 23.06.1881 Frankfurt am Main) und des Anatomen und Physiologen Theodor Ambrose
Hubert Schwann (07.12.1810 Neuss - 14.01.1882 Köln) aus, nach der die Zelle aus einer amorphen Proteinmasse, die Blastem, später Protoplasma genannt (die Art der Zellbildung als der
Kristallisation analog) entstehen. Diese Schleiden-Schwann´sche Zelltheorie stellte sich als falsch heraus, was F. W. Beneke damals aber nicht wußte. Er versuchte, die eigentlichen Grundstoffe
des Protoplasmas darzustellen; dabei gelang ihm die Reindarstellung des Cholesterins (Beneke, 1862 a). In diesem und dem Lecithin sah er eine besondere Bedeutung für die Zellentstehung und
Zellphysiologie. Er betrachtete sie auch als die Bestandteile einer „reizbaren Substanz“, die durch äußere Reize wie z. B. Licht und Wärme über das Nervensystem beeinflußt würden und ihrerseits
Auswirkungen auf die physikalisch-chemischen Vorgänge in der Zelle hat. Friedrich Wilhelm Beneke sagte über die durch äußere Einflüsse modifizierten Zellvorgänge:
„Es handelt sich nicht mehr lediglich um chemische und physikalische Ausgleichungen, sondern zugleich um eine Regulirung und Beeinflussung der Stoffwechselvorgänge von Seiten des mit besonderen
Lebenseigenschaften ausgestatteten Protoplasmas der Zellenleiber“. Damit verband er die „Vorstellung von einer activen Betheiligung der Zellen bei dem Ernährungsvorgang“ des gesamten Organismus
(Beneke, 1874).
F. W. Beneke stellte in diesem Zusammenhang auch Überlegungen an, die deutlich auch Vorstellungen der Humoralphatologie enthielten. Unter der Bezeichnung „Proportionsstörungen“ faßte er solche
Stoffwechselstörungen zusammen, die durch „fehlerhafte Mischung des eingeführten Nahrungsmaterials“ oder durch die Fehlfunktionen von Organen (und damit von den sie aufbauenden Zellen) bedingt
wurden.
Proportionsstörungen der den Organismus aufbauenden Substanzen riefen nach F. W. Beneke Krankheitserscheinungen hervor, die er im Laufe seiner Tätigkeit als praktizierender Arzt eingehend
beobachtete. Um eine geeignete Therapie anzubieten, die nicht nur Symptome, sondern auch Ursachen einer Krankheit erfaßten, stellte er umfassende Untersuchungen über die Propertionsstörungen an
(Beneke, 1874; Schmitter, 1986).
Für das pathologische Institut wurden 1858 Räumlichkeiten im Landeskrankenhaus Marburg zur Verfügung gestellt. Diese sollten für Sektionen, andere Arbeiten und für die Aufstellung der Präparate
hergerichtet werden. Dazu wurden F. W. Beneke 20 Mark für die Einrichtung dieses neuen Instituts zur Verfügung gestellt. In einem Schreiben vom 27. November 1858 an einen Regierungsrat bat er um
weitere finanzielle Unterstützung, da er bereits zahlreiche Gegenstände auf eigene Kosten angeschafft hatte. Er schrieb (Schmitter, 1986):
„Marburg, 27. Nov. 1858
Hochwohlgeborener,
Hochgeehrtester Herr Regierungs - Rath!
Gestatten Sie mir zunächst, Ihnen meinen aufrichtigen Dank zu bezeugen für die bereitwillige Unterstützung, welche Sie meinen ergebensten Vorschlägen in Betreff eines in Marburg zu
errichtenden pathologischen Institutes haben zu Theil werden laßen. Ich bin dadurch wahrhaft erfreut, und hoffe zu Gott, daß es mir gelingen wird, mit Hilfe eines solchen Institutes, der
wißenschaftlichen Ausbildung der Aerzte unseres Landes förderlich zu sein. Die nothwendigen macroscopischen und microscopischen Demonstrationen, welche ich bisher ganz vernachläßigen mußte,
werden jetzt meinen theoretischen Vorträgen zur Seite gehen können.
Es erhebt sich nun aber noch eine Schwierigkeit, im Betreff deren Überwindung ich mir Eur. Hochwohlgeborenen geschätzten und gefälligen Rath erbitten möchte. - Es sind mir allerdings die
Räumlichkeiten für das Institut überwiesen aber das ist auch Alles und die ganze Einrichtung habe ich jetzt selbst vorzunehmen. Ich habe allerdings keinen Augenblick gesinnt, mit dieser
Einrichtung vorzuschreiten und zwar - so weit die mir überwiesenen 20 M nicht zureichten - auf eigene Kosten. - Allein auf die Dauer läßt sich das doch schwerlich durchführen und sollen die von
mir angeschafften Gegenstände Eigenthum des Institutes werden, so müßten mir die Auslagen ersetzt werden.
Als dringendste Erforderniße habe ich, zunächst, auf meine Kosten, angeschafft:
1. Zwei in die Fensternischen zu stellende Tische für die Aufstellung von Microscopen - (zusammen 5 M)
2. Einen großen Arbeitstisch für chemisch-anatomische Arbeiten mit Auszügen und Repositorien für Apparate u.s.w. - (14 ½ M)
3. Einen kleinen Herd für chemische Untersuchung pathologischer-anatomischer Präparate mit Sandbad und Vorrichtung zum Glühen - (circa 10 M)
4. Ein anatomisches Besteck für Sectionen, da das alte der medicinischen Klinik gehörige ganz abhängig ist und mir ohnedies nicht ohne Weiteres überwiesen werden konnte - (etwa 15
M)
Diese Gegenstände waren mir zunächst unerläßlich nöthig. - Soll nun aber die pathologisch-anatomische Sammlung auch transferiert werden, so stehen mir die Präparate allerdings höchster
Verfügung gemäß zu Gebote, aber ich habe keine Schränke und keine Repositorien dazu. Herr Prof. Eick will diese nur gegen eine entsprechende Entschädigung hergeben. - Soll ferner, was ich so sehr
wünsche, die Sammlung fernerhin vervollständigt werden, so sind mir Gläser und Spiritus erforderlich. - Für die Schränke und Repositorien dürfte sich die erste Auslage auf etwa 150 - 200 M
stellen, die laufenden Ausgaben für Spiritus u[nd] Gläser jährlich etwa auf 20 M.
Hiernach berechne ich, daß zur vollständigen ersten Einrichtung des ganzen Institutes, die Summe von etwa 250 M erforderlich sein wird, daß die laufenden jährlichen Ausgaben
sich aber auf etwa 60 - 80 M stellen werden. Abgesehen von Spiritus und Gläsern, soll ich dem Krankenhaus, (laße auch) für Heizung eine Avarionel Summe zahlen, und meinem Sections-Diener werden
halbjährig etwa auf 10 - 12 M zukommen müßen. -
Ich erteilte mir nun Eur. Hochwohlgeborenen, gefälligen Rath, ob ich etwa schon sogleich mit einem ergebensten Antrage auf Bewilligung dieser Gelder mich an hohes Ministerium wenden soll,
oder ob es geeigneter sein dürfte, noch eine Zeit lang damit zu warten? - Die Transferierung der Sammlung müßte im letzteren Falle dann noch eine Zeit lang gestopt werden, was mir für den
diesjährigen Unterricht allerdings nicht sehr lieb wäre. Im Uebrigen bin ich gerne bereit, so lange mit eigenen Mitteln auszuhelfen, bis eine höhere weitere Bestimmung getroffen sein wird. Da mir
vor Allem daran liegt, das Institut sofort nutzbar zu machen. -
Verzeihen Eur. Hochwohlgeboren diese meine Belästigung. Bei meiner ersten Eingabe an hohes Ministerium habe ich nicht daran gedacht, daß man mir wohl die Sammlung von Präparaten, aber nicht die Schränke dazu, daß man mir ferner wohl die Zimmer im Landeskrankenhause, aber nicht die nothwendigen Tische u.s.m. geben würde, welche letztere freilich aber auch in einem Zustand befindlich sind, daß man sie kaum noch zu unseren Zwecken verwenden kann. - Es bedarf gewiß keiner Versicherung, daß ich Alles auf das Billigste einrichten werde; aber ich möchte auch keine Anschaffung unterlassen, ohne welche das Institut eine nur lückenhafte Einrichtung haben würde... -
Genehmigen Eur. Hochwohlgeborenen, zum Schluß den Ausdruck meiner vorzüglichsten Hochachtung,
mit welcher ich die Ehre habe zu verharren
fm. Hochwohgeboren
ganz ergebenster
Beneke“
Die zahlreichen späteren Arbeiten von Friedrich Wilhelm Beneke aus der Pathologie zeigen auf, daß es ihm gelang, sein Institut zeitgemäß einzurichten (Schmitter, 1986).
Neben seinen ergebnisreichen chemischen Arbeiten entwickelte der pathologische Anatom F. W. Beneke ab etwa 1868 ein Konzept, die bis dahin chemisch gefaßten „Konstitutionen“ anthropometrisch
darzustellen. Durch systematische Organwägungen und -messungen stelle er „Anatomische[n] Grundlagen der Constiutionsanomalieen“ (1878) auf (Beneke, 1878). Unter Konstitution versteht man die
anlagebedingte Gesamtheit aller psychischen und körperlichen Eigenschaften und Merkmale eines Organismus, der seine Reaktivität, Leistungsfähigkeit und Verhaltensweise gegenüber seiner Umwelt
bestimmt. Konstitution ist genetisch bestimmt und wird durch die Umwelt beeinflußt. Im Mittelpunkt der Arbeiten von F. W. Beneke standen die anatomische Lebensgeschichte des Herzens sowie der
Hauptschlagader, wobei er grobe Gesetze und Relationen des Wachstums aller Teile in gesunden und kranken Körpern entdeckte. Aus diesen leitete er 1879 die Grundlagen der „Altersdispersion“ ab
(Beneke, 1879). Dabei sah F. W. Beneke die Funktionsgröße wie die anatomischen Maße selbst als überwiegende und unmittelbare Erblichkeitsfolgen an. Eine theoretische Analyse und die Abgrenzung
aller zusammenwirkenden Faktoren hat er unterlassen. In mehreren Publikationen über die Ergebnisse der Messungen an dem wachsenden Material und ein zusammenfassendes Werk über „Constitution und
constitutionelle Krankheiten“ (1881) führte er die Konstitutionfragen auf auf immer einfachere Vorstellungen zurück. Im Wesentlichen waren es die Gegensätze erworbener und angeborener Über- und
Untermaße sowie die allgemeinen und örtlichen Stoffwechselenergien (Beneke, 1881 a). Erst lange Jahre nach seinem Tode fanden diese Arbeiten Bestätigung und Aufnahme und Wertung in der Literatur.
F. W. Beneke zählt heute zu den Begründern der systematischen Anthropometrie (Lehre von Maßen und Maßverhältnissen des menschlichen Körpers) und einer objektiven Konstitutionslehre (Beneke R.,
1929, 1935, 1939).
Die berüchtigtsten Anwender der Anthropometrie waren die Nazis, deren Propagandaabteilung für Bevölkerungspolitik und Rassenwohl die Einteilung von Ariern und Nichtarieren auf der Basis von
Schädelmessungen und anderer körperlicher Eigenschaften empfahl. Schädeleinteilung war gesetzlich vorgeschrieben; die Nazis riefen eigene Institute ins Leben, um ihre Rassenpolitik zu fördern.
Wenn man den Normen nicht entsprach, bedeutete dies Entzug der Heirats- oder Arbeitserlaubnis und für viele den Weg in die Todeslager.
Heutzutage wird Anthropometrie für viele nützliche Zwecke verwendet, zum Beispiel bei der Feststellung der Ernährungslage, dem Wachstum von Kindern und bei der Gestaltung von Büromöbeln.
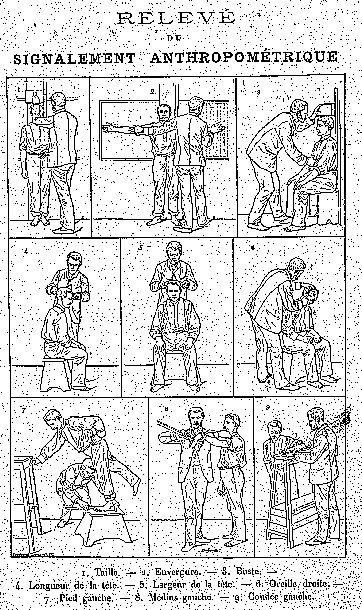
L'écrou et l'anthropométrie Instructions signalétiques
par Alphonse Bertillon, Melun, 1893
Es kam zu politischen Spannungen zwischen dem Königreich Preußen und dem Kaiserreich Frankreich (seit 1852 Kaiserreich, ab 1870 Republik), die in der Streitfrage gipfelten, ob ein Prinz von
Hohenzollern (Prinz Leopold Stephan von Hohenzollern-Sigmaringen), ein Verwandter König Wilhelm Friedrich von Preußen (22.03.1797 Berlin - 09.03.1888 Berlin), sowie spätere Nachfolger aus dem
Hause Hohenzollern für die spanische Thronfolge kandidieren sollten. Frankreich empfand eine Herrschaft der Hohenzollern in Preußen und zusätzlich in Spanien als Bedrohung. Es kam zum
Deutsch-Französischen Krieg 1870/71. Dieser wurde vom 1866/67 gegründeten Norddeutschen Bund (Preußen und alle anderen deutschen Staaten nördlich der Mainlinie) und den süddeutschen Staaten
(Bayern und die übrigen deutschen Länder südlich der Mainlinie) geführt. In der Entscheidungschlacht von Sedan am 1. September 1870 kapitulierte der französische König Napoleon III (genannt Louis
Napoléon, eigentlich Charles Louis Napoléon Bonaparte (1808 - 1873), Kaiser der Franzosen 1852 bis 1870) mit 83 000 Soldaten vor den Deutschen und wurde mit seiner gesamten Armee gefangen
genommen. Als die Nachricht der Gefangennahme des Kaisers in Paris eintraf wurde die gesetzgebende Versammlung aufgelöst. Am 4. September 1870 wurde die französische Republik ausgerufen.
Der Krieg endete schließlich mit dem Sieg der deutschen Staaten, die sich 1871, noch vor Beendigung der Auseinandersetzung mit Frankreich, zum Deutschen Reich unter Kaiser Wilhelm I. (König Wilhelm Friedrich von Preußen) zusammengeschlossen hatten.
Im diesem Deutsch-Französischen Krieg leitete Friedrich Wilhelm Beneke für kurze Zeit ein Lazarett in Rémilly, später in Nancy. Dort führte er Maßuntersuchungen an Gefallenen nach dem
Gesichtspunkte durch, daß sich hier für die Lebensstatistik wertvolle Normalmaße für junge Erwachsene ergaben, die in seinen späteren Werken verwendet wurden. Sein Sohn Rudolf Beneke schätzte,
daß F. W. Beneke in seinem ganzen Leben etwa 3 000 Sektionen durchgeführt hat (Beneke R., 1935). Im Deutsch-Französischem Krieg fielen 139 000 französische und 41 000 deutsche Soldaten.
Für sein pathologisches Institut mußte F. W. Beneke weiterhin für Geld und für die Ausrüstung kämpfen.
In einem Brief an seinen Kollegen in Marburg, den evangelischen Theologen Wilhelm Julius Mangold (1825 - 1890) vom 19. Januar 1872 schrieb F. W. Beneke (Schmitter, 1986):
Napoleon III.
„Hochverehrter Herr College!
Der trostlose, völlig ungenügende Zustand meiner Direction unterstellten pathologischen Institutes treibt mich, Ihnen die besondere Bitte vorzutragen, während Ihrer Anwesenheit in Berlin, sei es bei der Berathung des Unterrichts-Etats öffentlich, oder sei es insgeheim Ihr Intereße auch diesem Institute zuwenden zu wollen.
Mein Institut besteht aus 3 Räumen: einem Sectionszimmer, einem Sammlungssaal und mein s[o] g[enanntes] Arbeitszimmer. Ich bin genöthigt im Sammlungssaal zu lehren. Durch den ständigen Temperaturwechsel in demselben (in Folge des Heitzens) verderben uns die schönsten Präparate und der Raum selbst ist bei der jetzt großen Anzahl von Zuhörern so klein u[nd] ungenügend, daß die letzteren zum Theil auf den Knien schreiben müßen. In dem „Arbeitszimmer“ werden chemische und microscopische Arbeiten vorgenommen. Durch jenes werden die Microscope beschädigt, da sie vor den Säure-Dämpfen u. s. w. nicht zu schützen sind. - Der Raum ist absolut unzureichend, nur 2 Zuhörer arbeiten zu laßen, und microscopische und chemische Curse habe ich seit 2 Jahren total aufgeben müßen. Zudem ist das Local - wirklich unwürdiger Weise, der Aufenthaltsort für mich, meinem Gehilfen und meinem Diener; ich kann kaum einen Zuhörer privatime sprechen, und befinde mich täglich in dieser Beziehung in der unangenehmsten Situation. -
Es bedarf Ihnen gegenüber, verehrter Herr College, wohl kaum der Andeutung, daß unter solchen Verhältnißen auch der ausdauernste Eifer für das Wohl der Studierenden zu sorgen, erlahmen muß, und da nach den diesjährigen Etataufstellungen und auch noch pro 1873 nichts für das pathologische (und eben so wenig für das physiologische) Institut zu hoffen steht, so sehe ich diesem Jahre wahrhaft unmuthig und unwillig entgegen. -
Niemand kann mehr und mit mehr Liebe für seine Lebensaufgabe arbeiten, als ich es thue. Die wortbrüchige und treulose Behandlung welche mir 1866 zu Theil geworden ist, hat meine Gesundheit zeitweilig untergraben, aber meinen Lebensmuth und meine Arbeitsfreude noch nicht geknickt, eben so wenig, wie die actenmäßig zu erweisenden, schändlichen, hinter dem Rücken der Facultät bei dem vormaligem heßischen Ministerium gemachten, und zwar von Herrn Stepmann niedergeschriebenen Anfeindungen gegen mich. - Ich habe die volle Freude einer immer wachsenden Anhänglichkeit meines jetzt großen Kreises von Schülern, und empfinde dieselbe mehr als je in diesem Semester. Was will der Staat mehr von seinen Dienern, als daß sie treu und mit Erfolg arbeiten? - Unter solchen Verhältnißen, die ich sämmtlich wiederholt dem Ministerium zur Kenntniß gebracht habe, dürfte ich aber doppelt erwarten, daß man mich jetzt in meiner Thätigkeit förderte, statt hemmte - und ich meine, ein Betrag von etwa 20 000 M[ark], wie er zum Neubau eines Institutes erforderlich ist, kann in einem Staate Preussen kein ernsthaftes Hinderniß bieten.
Haben Sie, verehrter College, die Güte, dieser Zeilen sich bei paßender Gelegenheit zu erinnern, und verhelfen Sie mir damit so bald als möglich zu einem Arbeitslocale, in welchem ich erst die (genüge) jenige Lehrthätigkeit zu entwickeln vermag, wie ich sie dem jetzt in Marburg weilenden großen Zuhörerkreise zuwenden möchte u[nd] muß, wenn, ich die Befriedigung der Selben herbeiführen soll.
Mit herzlichem Gruß und treuer Verehrung
Ihr ergebener
Beneke“
...zur Fortsetzung der Biografie - Teil 2
 crowdfunding-bad-nauheim
crowdfunding-bad-nauheim











































